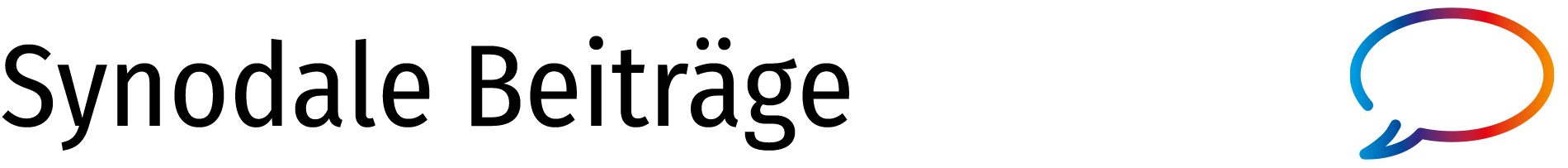13. Mai 2021 | Eine Antwort auf das „Forum I“ des Synodalen Weges der katholischen Kirche in Deutschland
Autor: Samuel J. Aquila Erzbischof von Denver
Quelle: http://document.kathtube.com/51633.pdf
„Wer aber mein Wort hat, der verkünde mein Wort in Wahrheit“ (Jeremias 23,28)
„Nur einer ist euer Lehrer, Christus“ (Matthäus 23,10)
An meine Brüder im Bischofsamt und ganz besonders an die Bischöfe Deutschlands, Grüße in Christus Jesus.
I. Die Autorität des Herrn Jesus Christus
Das Matthäusevangelium berichtet, dass am Ende der Bergpredigt Jesu „die Menge erstaunt war über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie ihre Schriftgelehrten“ (Mt 7,28-29; vgl. Mk 1,22; Lk 4,32). Die Jünger Jesu sollten erkennen, dass seine unübertroffene Autorität (exousia) von seiner Identität als „der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes“ (Mt 16,16) herrührte. Er redete nicht aus eigener Kraft, sondern nur als der eingeborene Sohn, der vom ewigen Vater gesandt wurde (Joh 7,16-18; 8,28; 12,49; 14,10). Wie Jesus selbst sagt: „Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden; niemand kennt den Sohn, nur der Vater, niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will“ (Mt 11,27).
Die Autorität Jesu als Sohn wurde durch die Auferstehung glorreich bestätigt, woraufhin er den Elf feierlich einen Anteil an dieser Autorität gewährte und sie beauftragte, seine Lehre zu verkünden: „Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf Erden. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern; tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt“ (Mt 28,18-20).
In den Tagen vor Pfingsten, als die Jünger auf den Heiligen Geist warteten, wurde Matthias ausgewählt, um Judas im Kollegium der Zwölf zu ersetzen (Apg 1,8, 21-26). Dies unterstreicht die Bedeutung derjenigen, die der Herr Jesus gewählt hatte, um „auf Thronen zu sitzen und die zwölf Stämme Israels zu richten“ (Lk 22,30). Es zeigt auch, dass die Vollmacht, die die Apostel von Christus erhalten haben, weitergegeben werden konnte.
Auch Paulus spricht unmissverständlich von seiner eigenen apostolischen Autorität. Er hat diese Autorität direkt von Gott erhalten (Gal 1,1), wie es die Vertreter der Zwölf anerkennen (Gal 2,9), und er lobt die Gläubigen in Thessaloniki dafür, „dass ihr das Wort Gottes, das ihr durch unsere Verkündigung empfangen habt, nicht als Menschenwort, sondern – was es in Wahrheit ist – als Gottes Wort angenommen habt“ (1 Thess 2,13). Wie die Jerusalemer Apostel betrachtet Paulus diese Autorität als übertragbar. Nach der Apostelgeschichte setzten er und Barnabas am Ende der Missionsreise des Paulus „in jeder Gemeinde Älteste [presbyterous]... ein“ (Apg 14,23). Später, auf dem Weg nach Jerusalem, warnt Paulus die Ältesten der Kirche in Ephesus (tous presbyterous tes ekklēsias, Apg 20,17) davor, „die Wahrheit zu verzerren“, um Anhänger zu gewinnen (Apg 20,30). Er erinnert sie daran, dass „die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist zu Vorstehern bestellt hat“, nicht ihre eigene ist, sondern „die Kirche des Herrn sorgt, die er sich durch sein eigenes Blut erworben hat“ (Apg 20,28). Es ist offensichtlich, dass sie echte Autorität tragen, für die sie zur Rechenschaft gezogen werden (Apg 20,26-27).
Doch die Autorität der Apostel und ihrer Nachfolger ist nicht ihre eigene. Es ist ein Anteil an der Autorität des Herrn Jesus Christus, der die Wahrheit ist (siehe Joh 14,6). Jeder Nachfolger der Apostel muss der Versuchung widerstehen, die „törichten Propheten, die nur ihrem eigenen Geist folgen“, in der Zeit Ezechiels nachzuahmen und ihre eigenen Meinungen und Ideen voranzubringen (Ez 13,3). Jeder Nachfolger der Apostel muss auch der Versuchung widerstehen, die Propheten und Priester in der Zeit Jeremiasʼ nachzuahmen, die ihre Lehre an den Vorlieben des Volkes angepasst haben (Jer 5,30-31). Jesus Christus ist „der treue Zeuge“ (Offb 1,5), und seine Vollmacht zu tragen heißt treu Zeugnis zu geben für „den Glauben, der den Heiligen ein für allemal anvertraut ist“ (Jud 3). Der Jünger steht nicht über dem Lehrer (Mt 10,24), also muss jeder Lehrer des christlichen Glaubens – und vor allem die Bischöfe – mit unserem Lehrer sagen können:
„Meine Lehre stammt nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat“ (Joh 7,16).
In Anbetracht der heiligen Verantwortung, dem Zeugnis zu geben, der mich gesandt hat, schreibe ich diesen Brief aus Liebe zu Jesus Christus und zur Weltkirche, die die Braut Christi ist. Wie Bischöfe vorangegangener Generationen in der Geschichte der Kirche, die ihren Brüdern geschrieben haben, als wichtige theologische Diskussionen stattfanden, sende ich Ihnen diesen Brief. Die meisten von uns außerhalb Deutschlands haben durch die Medien Kenntnis vom Synodalen Weg der katholischen Kirche in Deutschland und von der Freimütigkeit einiger Bischöfe bekommen, die radikale Veränderungen in der Lehre und Praxis der Kirche fordern. Einige haben auch den „Grundtext“ gesehen, der aus dem „Forum I“ des Synodalen Weges hervorgegangen ist. Ich empfehle diese Antwort Ihrem Gebet und Ihrer Reflexion, und ermutige andere Bischöfe, mutig Zeugnis zu geben von der Wahrheit des Evangeliums, von Jesus Christus, der „der Weg und die Wahrheit und das Leben“ ist (Joh 14,6).
II. «Forum I» des Synodalen Weges der katholischen Kirche in Deutschland
Der Synodale Weg der katholischen Kirche in Deutschland schlägt vor, vier „Foren“ zu bilden, die jeweils ein spezifisches Thema für die Kirche in Deutschland behandeln. Forum I befasst sich mit der Frage der „Macht und Gewaltenteilung in der Kirche“ durch einen langen und detaillierten «Grundtext».[1] Gerechterweise muss anerkannt werden, dass die Mitglieder der Synodal- versammlung mehrere Fragen von echter und dringender Bedeutung identifiziert haben.
Zuallererst bringt die Synodenversammlung zu Recht ihre Bestürzung über die Skandale des sexuellen Missbrauchs durch Geistliche und ihre Vertuschung durch einige Mitglieder der Hierarchie zum Ausdruck. Der Grundtext behauptet zu Recht, dass diese Skandale eine wahre Glaubwürdigkeitskrise für die Kirche ausgelöst haben. Dies ist nach wie vor ein dringendes Anliegen, das alle Hirten teilen müssen. Die Hirten der Herde Christi müssen für die rechtliche Kriminalität, die moralische Verwerflichkeit und die geistige Verderbnis dieser Gräueltaten zur Rechenschaft gezogen werden, und sie müssen sich auch mit der sündigen Selbstbezogenheit auseinandersetzen, die diese so oft ermöglichte. Vor allem müssen wir Priester und Bischöfe den schockierenden Mangel an unserer Liebe zu Christus und den Gläubigen in diesen Taten erkennen, uns damit auseinandersetzen und uns bekehren. Zu viele Priester und Bischöfe haben die deutliche
Warnung Christi nicht beachtet: „Wer einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Ärgernis gibt, für den wäre es besser, wenn ihm ein Mühlstein um den Hals gehängt und er in der Tiefe des Meeres versenkt würde“ (Mt 18,6). Zu viele hörten eher auf die Einflüsterungen des Teufels als auf die Stimme Jesu Christi.
Obwohl die finanziellen Auswirkungen der Missbrauchsskandale auf die Kirche gravierend waren, darf dies nicht die Hauptmotivation für Reformen sein. In dem Maße, in dem solche Konsequenzen gerecht sind, sind sie nicht zu beklagen, sondern sollten wie aus der Hand des gerechten Gottes empfangen werden. Stattdessen muss es uns am meisten darum gehen, das Vertrauen derer wiederzuerlangen, die Christus der Kirche anvertraut hat. Wir müssen uns verpflichten, denen, die durch die bösen Taten von Klerikern in der Kirche verwundet und oft am Boden zerstört wurden, seelsorgerische Hilfe anzubieten, Messen als Wiedergutmachung für die Sünden des Klerus und der Laien feiern, aufrichtige Reue und Buße öffentlich zu machen und echte Transparenz zu schaffen. Wenn die Kirche nicht bereit ist, mit Besonnenheit und Mut die Wahrheit über für ihre eigenen Leiter unangenehme Angelegenheiten zu sagen, warum sollte die Welt dann darauf vertrauen, dass die Kirche die Wahrheit über der Welt unangenehme Angelegenheiten sagt – das heißt, in ihrer Wiedergabe der Aufforderung des Herrn, „umzukehren und an die frohe Botschaft zu glauben“ (Mk 1,15)? Als Hirten müssen wir die ersten sein, die „umkehren und glauben“!
Die Synodalversammlung liegt richtig, wenn sie Bereiche identifiziert, in denen die Umsetzung des Zweiten Vatikanischen Konzils weiter voranschreiten muss. Die Aussage des Konzils über die Rolle der Laien in der Kirche muss noch mehr verwirklicht werden. Ebenso muss die Kirche, die sowohl den rationalistischen Historismus als auch den unkritischen Fideismus ablehnt, ihre Auslegung der Schrift und der Tradition als Träger der Sprache Gottes in der menschlichen Sprache weiter vertiefen. Darüber hinaus müssen wir die Vision des Konzils für einen starken und verantwortungsvollen Dialog mit den säkularen, pluralistischen Kontexten, in denen sich viele Mitglieder der Kirche befinden, weiter verfolgen. Dieser Dialog muss immer in Liebe und Wahrheit begründet sein, denn nur Jesus Christus, der die Wahrheit ist, wird uns befreien (Joh 8,31-32).
Einige der spezifischen Empfehlungen der Versammlung sind geeigneter als andere, um Schlagzeilen zu machen. Die Synode stellt nebenbei fest, dass viele von denen, die die Kirche verlassen, mit der katholischen Lehre über gleichgeschlechtliche Beziehungen und einer Ehe nach der Scheidung unzufrieden sind (Grundtext, 7-8). Während einige Mitglieder der deutschen Hierarchie bereits Schlagzeilen gemacht haben, indem sie offen Änderungen in der Praxis (und damit implizit in der Lehre) forderten – Forderungen, die der Hl. Stuhl durch die Kongregation für die Glaubenslehre mit dem Responsum vom 22. Februar 2021, am 15. März 2021 veröffentlicht, ausdrücklich zurückgewiesen hat – sind diese Angelegenheiten hauptsächlich dem Forum II des Synodalen Weges vorbehalten.
Bis zur Veröffentlichung der Ergebnisse des Forums II wäre es unangemessen, in diesen Fragen ausführlich auf den Synodalen Weg zu antworten. In der Zwischenzeit bekräftige ich meine Verpflichtung, insbesondere in diesem Jahr von Amoris laetitia, diejenigen zu begleiten, die die Verletzung einer zerbrochenen Familienbeziehungen erlitten haben (siehe Papst Franziskus, Amoris laetitia Nr. 243) sowie „diejenigen, welche die homosexuelle Tendenz zeigen“, damit sie „die notwendigen Hilfen bekommen können, um den Willen Gottes in ihrem Leben zu begreifen und ganz zu erfüllen“ (Amoris laetitia 250). Die Kirche hat die heilige Verpflichtung, Gottes Liebe zu jedem Menschen zu verkünden, eine Liebe, die so groß ist, dass er seinen Sohn gesandt hat, um die Welt zu retten (vgl. Joh 3,16-17; Röm 5,8). Die heilbringende Wahrheit des Evangeliums, wie sie von der Kirche in ihrer ganzen Unversehrtheit und Reinheit bewahrt und gelehrt wird (vgl. Dei Verbum Nr. 7, 9), hat wirklich einen universellen Geltungsanspruch.
Der Grundtext vom Forum I fordert direkt eine kritische Neubewertung der Bestimmung des hl. Johannes Paul II., „die Kirche habe kein Recht, Frauen zu Priestern zu weihen“, deren „Geltungskraft“ durch angeblich neue „Einsichten“ aus dem letzten Vierteljahrhundert geprüft werden muss, die die „Kohärenz seiner Argumentation“ in Frage stellen (Grundtext, S. 35). Diese Frage soll im Forum IV näher behandelt werden, aber ihre ekklesiologischen Grundlagen sind im Grundtext des Forums I angelegt.
Es wäre sowohl unmöglich als auch unerwünscht, Zeile für Zeile auf das gesamte Dokument zu antworten, aber es ist mehr erforderlich als eine oberflächliche Reaktion auf die Themen der Überschriften. Dies sind nur Symptome der tieferen Pathologien des Grundtextes und der theologischen Haltung des Synodalen Weges, dem das Dokument Ausdruck verleiht. Die Synodenversammlung schlägt in der Tat wirklich radikale Änderungen der Struktur der Kirche und ihres Verständnisses ihrer Sendung vor.
Auf der einer Ebene hängen die Vorschläge des Grundtextes von einer teilweisen und tendenziösen Darstellung des Ursprungs und der Art des ordinierten Amtes ab, die im Widerspruch zum endgültigen Verständnis der Kirche und ihrer Gründung durch Christus steht. Auf einer tieferen Ebene behauptet der Synodale Weg zwar, sich im Zweiten Vatikanischen Konzil zu verankern, bedient sich aber einer selektiven und irreführenden Interpretation der Konzilsdokumente, um unhaltbare Ansichten über das Wesen der Kirche (Lumen gentium), ihre Beziehung zur Welt (Gaudium et spes) und ihre Begründung in der göttlichen Offenbarung (Dei Verbum) zu stützen, Ansichten, die unmöglich mit einer vollständigen Lektüre des Konzils in Verbindung gebracht werden können. Das Ergebnis ist eine Vision von der Kirche, die Gefahr läuft, den Einzigen aufzugeben, der „Worte des ewigen Lebens“ hat (Joh 6,68).
III. Das Sakrament des heiligen Priestertums und die Struktur der Kirche
Um das Anliegen des Synodalen Weges zu rechtfertigen, die Leitung der Kirche zu demokratisieren und die Möglichkeit zu erwägen, Frauen zum Priestertum zuzulassen, wird implizit die wesentliche Unterscheidung zwischen dem Priestertum der Getauften und dem Amtspriestertum – wie deutlich in Lumen gentium Nr.10 bestätigt wurde – in Frage gestellt. Zwar bestätigt der Grundtext:
Das besondere Priestertum des Dienstes (ordo) ist um des gemeinsamen Priestertums aller willen notwendig, weil in ihm zum Ausdruck kommt, dass die Kirche nicht aus eigener Kraft das Wort Gottes verkünden und die Sakramente feiern kann, sondern dass Jesus Christus in der Kraft des Heiligen Geistes die Kirche zum Mittel des universellen Heilswillens Gottes macht. (Grundtext, S. 23)
Dies ist eine begrüßenswerte Artikulation, die an die Bemerkung des hl. Johannes Paul II. erinnert, dass die ausschließliche Befähigung der geweihten Priester, die Eucharistie zu feiern, den Charakter der Eucharistie als „eine Gabe, die auf radikale Weise die Vollmacht der Gemeinde überragt“, verdeutlicht (Ecclesia de Eucharistia Nr. 29; Hervorhebung im Original).
Nichtsdestotrotz versäumt es der Grundtext, dieses „besondere Priestertum des Dienstes“ eindeutig mit dem Sakrament des heiligen Priestertums zu verbinden, das von Jesus Christus selbst gewollt und eingesetzt wurde, und dieses Versäumnis erweckt jeden Anschein, absichtlich zu sein. In einer vielsagenden Passage erläutert der Grundtext die Ursprünge des ordinierten Dienstes wie folgt:
Das kirchliche Leitungsamt entwickelt sich im Neuen Testament so, dass auf dem Fundament der Apostel und Propheten (Eph 2,20-21) „Evangelisten“, „Hirten“ und „Lehrer“ (Eph 4,11) dem Wachstum des Leibes Christi dienen. In den Pastoralbriefen kristallisiert sich das Amt des „Bischofs“ (Episkopos) heraus (1 Tim 3,1-7), der mit Diakonen zusammenarbeitet (1 Tim 3,8-13) und mit Presbytern verbunden ist (Tit 1,5-9), allerdings im Zuge einer starken Zurückdrängung von Frauen. Aus diesen Anfängen hat sich das bei Ignatius von Antiochien greifbare Konzept entwickelt, dass ein Bischof einer Ortskirche vorsteht, auch wenn lange Zeit andere Leitungsformen, z.B. eine Presbyterordnung, die prägenden Anfänge der Kirche mitbestimmt haben. In diesen Prozessen einer Institutionalisierung bleibt der von Paulus beschriebene Ansatz prägend, dass es der eine Geist Gottes ist, der die vielen Gaben schenkt, von denen einige zu festen Leitungsdiensten werden, ohne dass sie durch ein Mehr oder Weniger an Gnade zu unterscheiden wären. (Grundtext, S. 19–20)
Der hier gewählte Ansatz scheint darauf abzuzielen, den endgültigen und dauerhaften Charakter des Sakraments des heiligen Priestertums zu untergraben. „Prozesse einer Institutionalisierung“ unterscheiden sich explizit vom Wirken des Geistes, der Gaben schenkt. Diese „Prozesse“ und die hierarchische Struktur, die sie hervorgebracht haben, sind daher, so vermutet man, historisch so bedingt, dass sie nur vorläufig sind. Sie hätten drastisch anders sein können und sie könnten es vielleicht noch werden. Tatsächlich unterstellt der Grundtext, dass sie von Anfang an (innerhalb des Kanons der Heiligen Schrift) durch eine schleichende Misogynie verdorben, wenn nicht sogar delegitimiert wurden („...allerdings im Zuge einer starken Zurückdrängung von Frauen“).
Wie jeder Gelehrte des Neuen Testaments oder der ersten Jahrhunderte der christlichen Geschichte weiß, sind die Daten, die für „Prozesse einer Institutionalisierung“ relevant sind, komplex. Doch gerade diese Komplexität macht die faktische Universalität des bischöflichen Amtes umso auffälliger. Der angesehene Historiker Robert Louis Wilken schreibt über das erste Jahrtausend des Christentums,
Überall dort, wo das Christentum angenommen wurde, wurde durch die Person des Bischofs eine Struktur geschaffen, die Kontinuität mit der christlichen Vergangenheit und der geistlichen Einheit mit Christen in anderen Teilen der Welt sicherstellte. Ignatius [von Antiochien] war Anfang des zweiten Jahrhunderts prophetisch, als er schrieb, dass dort, wo der Bischof ist, die Kirche ist [siehe Smyrnaeans 8,1-2]. Es gibt keine Beweise für dauerhafte christliche Gemeinschaften ohne das Amt des Bischofs. Selbst in fernen Ländern, als ein König den Glauben annahm, war eine der ersten Handlungen, Bischöfe aus schon bestehenden Regionen zu entsenden.[2]
Es stimmt, die ersten Daten über den Episkopat sind kompliziert, aber das gilt auch für eine Reihe von theologischen Fragen, die erst nach langwieriger Entwicklung und Debatte geklärt wurden, darunter so zentraler Fragen wie dem Kanon der Schrift, der Lehre von der Dreifaltigkeit und der Lehre von der Menschwerdung. Wie die trinitarischen und christologischen Kontroversen der Spätantike deutlich zeigen, handelt es sich dabei um keine einfachen Angelegenheiten. In der Tat können intelligente und gut informierte Studenten der historischen Belege aus rein rationalen Gründen vernünftigerweise zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen hinsichtlich der Stärke patristischer, exegetischer und theologischer Argumente für konziliare dogmatische Entscheidungen kommen. Dennoch war die Kirche immer dankbar zuversichtlich, dass sie sich, nachdem sie mit den kostbaren Geheimnissen des Heils betraut worden war, auf die Führung des Heiligen Geistes verlassen kann, den der Herr Jesus versprach, „alles zu lehren und euch an alles zu erinnern, was ich euch gesagt habe“ (Joh 14,26).
Dieses Vertrauen erstreckt sich auch auf die von der Kirche immer wieder bekräftigte Überzeugung, dass die Bischöfe die Nachfolger der Apostel sind, eine Überzeugung, die vom Zweiten Vatikanischen Konzil nachdrücklich bekräftigt wurde (siehe besonders Lumen gentium, Kap. 3; Dei Verbum, Kap. 2). Lumen gentium könnte kaum eindringlicher sein, wenn es um die Wiedereinsetzung der Lehre der direkten bischöflichen Nachfolge von den Aposteln und der göttlichen Institution dieser Nachfolge geht:
Wie aber das Amt fortdauern sollte, das vom Herrn ausschließlich dem Petrus, dem ersten der Apostel, übertragen wurde und auf seinen Nachfolger übergehen sollte, so dauert auch das Amt der Apostel, die Kirche zu weiden, fort und muß von der heiligen Ordnung der Bischöfe immerdar ausgeübt werden. Aus diesem Grunde lehrt die Heilige Synode, daß die Bischöfe aufgrund göttlicher Einsetzung an die Stelle der Apostel als Hirten der Kirche getreten sind. Wer sie hört, hört Christus, und wer sie verachtet, verachtet Christus und ihn, der Christus gesandt hat (vgl. Lk 10,16). (Lumen gentium Nr. 20; Hervorhebung hinzugefügt)
Im auffälligen Gegensatz zu Lumen gentium wird die Lehre von der direkten bischöflichen Nachfolge von den Aposteln im Grundtext völlig ausgespart. Abgesehen von einer vorübergehenden Anerkennung der Ausübung des Petrusdienstes durch den Papst (Grundtext, S.
40) und einer Erwähnung der Lehre Jesu an seine Jünger über die Bedeutung wahrer Größe (Grundtext, S. 26), sucht man vergeblich nach einem Hinweis auf die Zwölf im Grundtext. (In der Tat zeigt das Dokument einen erstaunlichen Mangel an Verweisen auf die Evangelien, die nach Dei Verbum Nr.18 „das Hauptzeugnis für Leben und Lehre des fleischgewordenen Wortes, unseres Erlösers“ sind).
Tatsächlich scheint der Grundtext eine Diskussion über die „Lehre des fleischgewordenen Wortes“ zu vermeiden, indem er nur von der Lehre der Kirche spricht. Die Vorstellung, dass der Kirche von Jesus selbst spezifischen Lehren anvertraut wurden, die bewahrt werden müssen – was das II.
Vatikanische Konzil als „Schatz des Glaubens“ (Dei Verbum Nr. 10) oder „Hinterlage der göttlichen Offenbarung“ (Lumen gentium Nr. 25) bezeichnet, ist nirgendwo zu finden.
Das Zweite Vatikanische Konzil erkennt zwar die Notwendigkeit einer intellektuell verantwortungsvollen Hermeneutik an, besteht aber auf einem Grundvertrauen in die historische Wahrhaftigkeit der Berichte des Evangeliums über die Lehre Jesu:
Unsere heilige Mutter, die Kirche, hat entschieden und unentwegt daran festgehalten und hält daran fest, daß die vier genannten Evangelien, deren Geschichtlichkeit sie ohne Bedenken bejaht, zuverlässig überliefern, was Jesus, der Sohn Gottes, in seinem Leben unter den Menschen zu deren ewigem Heil wirklich getan und gelehrt hat bis zu dem Tag, da er aufgenommen wurde (vgl. Apg 1,1-2). Die Apostel haben nach der Auffahrt des Herrn das, was er selbst gesagt und getan hatte, ihren Hörern mit jenem volleren Verständnis überliefert, das ihnen aus der Erfahrung der Verherrlichung Christi und aus dem Licht des Geistes der Wahrheit zufloß. (Dei Verbum Nr. 19; Hervorhebung hinzugefügt)
Es ist dieses Vertrauen auf die Evangelienberichte über die Lehre Christi, die als Grundlage für den Ansatz des Zweiten Vatikanischen Konzils dient, das ordinierte Amt der Kirche zu erklären.
Das Fehlen von Verweisen auf die Beziehung Jesu zu den Zwölf im Grundtext steht in scharfem Gegensatz zu dem, was in den Dokumenten des Zweiten Vatikanischen Konzils zu finden ist. In Lumen gentium beispielsweise ist die bischöfliche Leitung der Kirche in der Handlung Jesu in den Evangelien verwurzelt:
Die einzige Kirche Christi . . . zu weiden, hat unser Erlöser nach seiner Auferstehung dem Petrus übertragen (Joh 21,17), ihm und den übrigen Aposteln hat er ihre Ausbreitung und Leitung anvertraut (vgl. Mt 28,18 ff), für immer hat er sie als "Säule und Feste der Wahrheit" errichtet (1 Tim 3,15). Diese Kirche, in dieser Welt als Gesellschaft verfaßt und geordnet, ist verwirklicht in der katholischen Kirche, die vom Nachfolger Petri und von den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm geleitet wird. (Lumen gentium Nr. 8)
In Anlehnung an die Lehre des Konzils bekräftigt auch der Katechismus der katholischen Kirche die zentrale Rolle der Zwölf bei der Stiftung einer Grundstruktur für die Kirche durch Jesus:
Der Herr Jesus gab seiner Gemeinschaft eine Struktur, die bis zur Vollendung des Reiches bleiben wird. An erster Stelle steht die Wahl der Zwölf mit Petrus als ihrem Haupt [vgl. Mk 3,14-15]. Sie repräsentieren die zwölf Stämme Israels [vgl. Mt 19,28;Lk 22,30] und sind somit die Grundsteine des neuen Jerusalem [vgl. Offb 21,12-14]. (Nr. 765)
In ähnlicher Weise hat Papst Franziskus erklärt:
Zu bekennen, dass die Kirche apostolisch ist, bedeutet, die grundlegende Verbindung, die sie mit den Aposteln, hat hervorzuheben, mit jener kleinen Gruppe von zwölf Männern, die Jesus eines Tages zu sich gerufen hat, die er beim Namen genannt hat, damit sie bei ihm blieben und dann aussenden wollte, damit sie predigten (vgl. Mk 3,13-19). (Generalaudienz, 16. Oktober 2013; Hervorhebung hinzugefügt)
In derselben Ansprache fährt der Heilige Vater fort, die bischöfliche Autorität in der Verbindung der Bischöfe zu den Zwölf zu begründen: „Wenn wir an die Nachfolger der Apostel, die Bischöfe, denken – einschließlich des Papstes, denn auch er ist ein Bischof –, müssen wir uns fragen, ob dieser Nachfolger der Apostel erstens betet und dann, ob er das Evangelium verkündigt“ (ebd.; Hervorhebung hinzugefügt).
Erst 2016 veröffentlichte die Kongregation für die Glaubenslehre mit Zustimmung des Heiligen Vaters den Brief Iuvenescit Ecclesia, der die Beziehung zwischen hierarchischen und charismatischen Gaben klärt. Unter besonderer Berücksichtigung der Lehre von Lumen Gentium heißt es in dem Schreiben:
Im Blick auf die Heiligung jedes Gliedes des Gottesvolkes und die Sendung der Kirche in der Welt ragt unter den verschiedenen Gaben „die Gnade der Apostel heraus, deren Autorität der Geist selbst auch die Charismatiker unterstellt“ [Lumen gentium 7]. Jesus Christus selbst hat hierarchische Gaben gewollt, um seine einzige Heilsvermittlung zu allen Zeiten sicherzustellen. Deshalb „sind die Apostel mit einer besonderen Ausgießung des herabkommenden Heiligen Geistes von Christus beschenkt worden (vgl. Apg 1, 8; 2, 4; Joh 20, 22-23). Sie hinwiederum übertrugen ihren Helfern durch die Auflegung der Hände die geistliche Gabe (vgl. 1 Tim 4, 14; 2 Tim 1, 6-7)“ [Lumen gentium 21]. Die Zuteilung der hierarchischen Gaben muss also vor allem auf die Fülle des Weihesakramentes zurückgeführt werden, die durch die Bischofsweihe verliehen wird. (Iuvenescit Ecclesia Nr. 14)
Hier sehen wir ein Modell für eine zutiefst katholische Interpretation der „Kristallisation“ des Bischofsamtes in den Pastoralbriefen. Es ist keine nur provisorische institutionelle Konstellation der vorangegangenen Charismen des Geistes, sondern in seinen wesentlichen sakramentalen Umrissen eine Beschreibung davon, wie die den Aposteln von Jesus selbst übertragenen Munera des Lehrens, Heiligens und Leitens weitergegeben werden sollen. Iuvenescit Ecclesia erinnert uns daher daran, dass das Zweite Vatikanische Konzil in Lumen Gentium die hierarchische Konstitution der Kirche in der offensichtlichen Absicht Jesu Christi und des Heiligen Geistes selbst begründet. Es liegt daher nicht in der Zuständigkeit der Kirche, in Deutschland oder anderswo, sie grundlegend zu verändern.
Mit großer Traurigkeit müssen wir anerkennen, dass klerikale Macht missbraucht werden kann und manchmal missbraucht wurde, mit verheerenden Folgen (siehe Grundtext, S. 25-27). Die göttliche Quelle dieser Macht mehrt nur den Schrecken ihres Missbrauchs. Aber eine authentische katholische Reform muss sich vor allem immer vom Erlöser der Welt inspirieren lassen, der die hierarchische Struktur der Kirche in Weisheit und Liebe eingesetzt hat. Wir müssen in Demut wachsen und erkennen, dass all das Gute, das wir haben, von Gott kommt (siehe Jak 1,17). Unsere Herzen und unser Verstand müssen von Jesus Christus geformt werden, denn getrennt von ihm können wir nichts tun (Joh 15,5).
Es ist daher bedauerlich, dass der Grundtext davon ausgeht, dass der beste oder einzige Weg, die Machtausübung zu reformieren, darin besteht, sie durch ein System von „checks and balances“ zu aufzuteilen. Die Annahmen hinter einem solchen System sind es wert, ans Licht gebracht zu werden. Sind die Geistlichen und Laien Mitglieder des einen Leibes Christi, die dasselbe gemeinsame Gut der ewigen Erlösung suchen, oder trennen sie sich in Interessengruppen, die ihre eigenen Ziele in Konkurrenz zueinander verfolgen müssen? Ist Macht immer eine Frage des Selbstsucht, oder kann sie durch Gottes Gnade in Christus gereinigt werden? Anstatt einen klaren Aufruf zur Heiligkeit zu veröffentlichen, wie vom Zweiten Vatikanischen Konzil (Lumen gentium
5) vorgeschlagen und von Papst Franziskus in seinem Apostolischen Schreiben Gaudete et exsultate bekräftigt wurde, appelliert das Dokument an weltliche Modelle, die nicht von Christus geformt oder vom Heiligen Geist geleitet werden.
Der Grundtext (S. 26) bezieht sich nur kurz auf die ausdrückliche Lehre Jesu an die Zwölf, wie sie die Macht ausüben sollen, mit der er sie als Leiter seiner Kirche ausgestattet hat (Mt 20,24-28; Mk 10,41–45; Lk 22,24-27). Die Jünger sollen zwar mit göttlicher Autorität „binden“ und „lösen“ (Mt 18,18), und „auf Thronen sitzen, und die zwölf Stämme Israels richten“ (Lk 22,30), aber ihre Autorität dient dem Dienst und sollte dementsprechend ausgeübt werden – ein Punkt, der vom II. Vatikanischen Konzil hervorgehoben und im anschließenden päpstlichen Lehramt wiederholt wird (siehe z.B. Johannes Paul II., Pastores dabo vobis). Jesus selbst ist das Vorbild: „Ihr sagt zu mir Meister und Herr und ihr nennt mich mit Recht so; denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe“ (Joh 13,13- 15).
Das Beispiel Jesu gipfelt in der Kreuzigung, durch die er „sein Leben als ein Lösegeld für viele gibt“ (Mk 10,45). Das Kreuz ist also das Kriterium christlicher Macht und Autorität. Beispiele gibt es genug in der frühen Kirche. Man denke an den hl. Petrus, dessen Ermahnung an seine Mitältesten in 1 Petr 5 darauf beruht, dass er darauf besteht, an den Leiden Christi teilzuhaben (siehe 1 Petr 2,21; 4,1-2, 12-16). Wenn der hl. Paulus über sein Apostelamt nachdenkt, dann tut er dies gerade als einer, der „immer den Tod Jesu am Leib trägt“ (2 Kor 4,10). Bald nach der Zeit des Neuen Testaments wird der hl. Ignatius von Antiochien die enge Beziehung zwischen Episkopat und der Vereinigung mit Christus durch das Martyrium aufzeigen.
Nichts davon bedeutet, dass die Laien dem Klerus bei der Leitung der Kirche nicht helfen können oder sollten. Aber die Reform in der Kirche kann niemals erreicht werden, indem man einfach eine Macht aufteilt, die, so scheint es, auf Eigeninteresse ausgerichtet und unzureichend auf die Gaben und dem ausdrücklichen Willen Jesu rückbezogen ist. Die Synodalversammlung bestreitet zu Recht, dass die hierarchischen Gaben von anderen im Sinn einer bloßen Rangordnung unterschieden werden (gekennzeichnet mit "mehr" oder "weniger" Gnade). Aber es bleibt wahr, wie das Zweite Vatikanische Konzil lehrt und das päpstliche Lehramt weiterhin bestätigt hat, dass es eine hierarchische Ordnung unter den Gaben gibt, gerade um des Ganzen willen. Papst Franziskus fordert, dass „auch das Papsttum und die zentralen Strukturen der Universalkirche […] es nötig [haben], dem Aufruf zu einer pastoralen Neuausrichtung zu folgen“ (Evangelii gaudium Nr. 32). Der „Größte“ muss der Diener aller sein. Die Tatsache, dass es nicht jedem Nachfolger Petri gelungen ist, wirklich servus servorum Dei zu sein, macht den Titel nicht ungültig, der die Wahrheit des päpstlichen Amtes und in der Tat aller ordinierten Ämter wunderbar ausdrückt. Die christliche Macht muss durch Umkehr und demütigen Dienst der Gläubigen immer wieder gekreuzigt werden. Sie muss der selbstgebenden Liebe Christi entsprechen, in der wir „nicht auf [unser] eigenes Wohl schauen, sondern auf das der anderen“ (Phil 2,4), und gemeinsam nach einem einzigen Ziel streben: „der Siegespreis: der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus“ (Phil
3,14). Bei der Reinigung der Autoritätsstrukturen der Kirche gibt es keine Alternative zur Buße und zum aufrichtigen Streben nach Heiligkeit.
IV. Die Kirche als Gesellschaft und Sakrament
„Die Heiligung, ohne die keiner den Herrn sehen wird“ (Heb 12,14), ist der Leitstern der Pilgerreise des Volkes Gottes auf Erden. Von ihr sagt uns die Schrift, dass „alles, was für unser Leben und unsere Frömmigkeit gut ist, seine göttliche Macht uns geschenkt hat“ (2 Petr 1,3). Die Kirche auf Erden kann dank dieser gnädigen Versorgung sicher zu ihrer himmlischen Heimat gelangen. Dennoch sieht der Grundtext die Diskussion des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Kirche auf Erden als ecclesia peregrinans („pilgernde Kirche“) als eine Ablehnung der traditionellen Beschreibung der Kirche als societas perfecta mit der Begründung, dass letzteres „das statische, in sich geschlossene und selbstgenügsame Bild“ sei, das „mit der Erkenntnis, eine lernende Kirche zu sein ... wenig vereinbar“ ist (Grundtext, S. 13). Aber das heißt, die Bedeutung von societas perfecta misszuverstehen. Eine „vollkommene Gesellschaft“ (societas perfecta), wie sie traditionell verstanden wird, ist eine, die über alle Mittel verfügt, die für die Erreichung ihres eigentlichen Zieles notwendig sind. Das Ziel der pilgernden Kirche ist das ewige Leben, für dessen Erreichung uns das Neue Testament versichert, dass Christus die Heiligen voll ausgerüstet hat (vgl. Eph 4,12). Auch wenn es gut sein mag, die leicht missverstandene Terminologie von societas perfecta in einigen Zusammenhängen zu vermeiden, sollte man doch anerkennen, dass das Zweite Vatikanische Konzil den Inhalt des Ausdrucks klar bekräftigt hat: Jesus Christus „selbst hat [die Kirche] ja mit seinem Blut erworben (vgl. Apg 20,28), mit seinem Geiste erfüllt und mit geeigneten Mitteln sichtbarer und gesellschaftlicher Einheit ausgerüstet“ (Lumen gentium 9; Hervorhebung hinzugefügt). Diese „Mittel“ sind umfassend, insofern "die katholische Kirche mit dem ganzen Reichtum der von Gott geoffenbarten Wahrheit und der Gnadenmittel beschenkt ist" (Unitatis redintegratio 4; Hervorhebung hinzugefügt). Zugegeben, Christen, einschließlich der Hirten der Kirche, versäumen es oft, „mit der entsprechenden Glut daraus zu leben“ (ebd.), manchmal auch auf schmerzliche Weise. Doch das Versagen der Mitglieder der Kirche kann nicht als Freibrief verstanden werden, dass die Gaben des Hauptes der Kirche mangelhaft sind. Im Gegenteil, unsere Versäumnisse, die uns so schmerzlich daran erinnern, dass die Kirche „zugleich heilig und stets der Reinigung bedürftig“ ist (Lumen Gentium Nr. 8), sollten uns zur Umkehr und zu einer tieferen Rückbesinnung auf die „von Gott geoffenbarten Wahrheiten“ und „Gnadenmittel“ bringen, die der Geist Christi in der Kirche bewahrt hat, damit sie „in Christus gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit“ (Lumen gentium Nr. 1) sei.
Der Grundtext gibt zwar vor, die Kirche als „Sakrament“ zu betrachten (Grundtext, S. 16–18). Dennoch interpretiert er den quasi-sakramentalen Charakter der Kirche als „Zeichen und Werkzeug“ in bemerkenswert anthropozentrischen Begriffen. „Ein Zeichen („signum“) muss verstanden werden und dazu die Sprache seiner Rezipienten sprechen. Unverstanden ist es kein bedeutsames Zeichen, sondern nur ein toter Buchstabe“ (Grundtext, S. 17). Natürlich müssen alle Mitglieder der Kirche, einschließlich ihrer Hirten, versuchen, die rettende Botschaft Christi auf eine Weise zu vermitteln, die von einer gemeinsamen Grundlage ausgeht und daher verständlich ist. Aber das ist erst der Anfang. Schließlich sind wir alle mit der Andersartigkeit des transzendenten Gottes konfrontiert, dessen Gedanken nicht unsere Gedanken sind und dessen Wege nicht unsere Wege sind (vgl. Jes 55,8), sondern der zu uns gesprochen und uns zur Erneuerung unseres Geistes eingeladen hat (vgl. Röm 12,2), uns in dominico eloquio zu üben—in der Art des Herrn zu sprechen (vgl. Augustinus, Bekenntnisse 9,5,13).
In ähnlicher Weise heißt es im Grundtext, dass „was als Werkzeug („instrumentum“) taugen soll, […] griffig und effizient sein [muss], auf seine Effektivität hin designt und im Umgang gefahrlos gebraucht werden können“ (Grundtext, S. 17). Aber dies missversteht gewaltig die traditionelle Art, von sakramentaler Instrumentalität zu sprechen. Die Sakramente – und noch viel weniger die Kirche! – sind nicht unsere „Werkzeuge“. Sie sind Gottes Werkzeuge, denn er allein ist die wichtigste effiziente Ursache für alle Gnaden, die durch die Kirche und die Sakramente vermittelt werden. Die Kirche Christi wird „von ihm als Werkzeug der Erlösung angenommen“ (Lumen gentium Nr. 9; Hervorhebung hinzugefügt). Wie Lumen gentium Nr.1 lehrt und der Grundtext anerkennt (Grundtext, S. 16), besteht die „Erlösung“, die die Kirche als Zeichen und Instrument Gottes bezeichnet und vermittelt, in der „innigste[n] Vereinigung mit Gott“ und der „Einheit der ganzen Menschheit“. Die Geschichte legt ein düsteres Zeugnis von den Schwierigkeiten ab, die menschliche Einheit in einer durch die Erbsünde verwundeten Welt zu verwirklichen (siehe Gaudium et spes Nr. 77–78). Der Frieden und die Harmonie untereinander, für die wir geschaffen wurden, gibt es nur noch, wie Lumen gentium Nr. 1 betont, „in Christus“, also durch das Ostergeheimnis des Sohnes Gottes. Die menschliche Einheit ist in einer „innigste[n] Vereinigung mit Gott“ zu finden, einer reinen Gabe der Gnade, die die natürlichen Grenzen der Menschheit übersteigt. Papst Franziskus hat uns daran erinnert: „Die Kirche geht hervor aus dem Wunsch Gottes, alle Menschen zur Gemeinschaft mit sich zu rufen, in seine Freundschaft, ja sogar als seine Söhne und Töchter an seinem göttlichen Leben teilzuhaben“ (Generalaudienz, 29. Mai 2013; Hervorhebung hinzugefügt). Jeder Getaufte wird zu einer „neuen Schöpfung“, die vom Heiligen Geist erfüllt ist und ruft: „Abba, Vater“ (2 Kor 5,17; Gal 4,6). Der sakramentale Charakter der Kirche als signum et instrumentum übertrifft daher rein soziologische Kategorien.
V. Die Kirche und die Welt
In der Heiligen Schrift hat der Begriff „Welt“ mehr als eine Bedeutung, manchmal sogar innerhalb desselben Buches der Bibel. Im Johannesevangelium kann sich „die Welt“ auf die Schöpfung als solche beziehen (Joh 1,10), die der Bezugspunkt der unvergleichlichen Liebe Gottes und Empfängerin des göttlichen Lebens durch Christus bleibt (z.B. Joh 3,16-17; 6,33, 51), aber sie kann auch die Menschheit gerade in ihrem gefallenen Zustand bezeichnen, indem sie sich durch Sünde von Gott abgewandt hat (z.B. Joh 7,7; 14,17; 15,19). Beide Bedeutungen von „Welt“ werden in Gaudium et spes, der Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Kirche in der modernen Welt, anerkannt. Die meiste Zeit benutzt Gaudium et spes „Welt“, um sich einfach auf „die ganze Menschheitsfamilie mit der Gesamtheit der Wirklichkeiten, in denen sie lebt [zu beziehen]; die Welt, der Schauplatz der Geschichte der Menschheit, von ihren Unternehmungen, Niederlagen und Siegen geprägt; die Welt, die nach dem Glauben der Christen durch die Liebe des Schöpfers begründet ist und erhalten wird“ (Nr. 2). Aber das Konzil fährt fort anzuerkennen, dass dieselbe Welt, „die unter die Knechtschaft der Sünde geraten [ist], von Christus aber, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, durch Brechung der Herrschaft des Bösen befreit wurde; bestimmt, umgestaltet zu werden nach Gottes Heilsratschluß und zur Vollendung zu kommen“ (ebd.; Hervorhebung hinzugefügt). Später lesen wir, dass das Konzil „nicht davon absehen [kann], das Wort des Apostels einzuschärfen: "Macht euch nicht dieser Welt gleichförmig" (Röm 12,2), das heißt, dem Geist des leeren Stolzes und der Bosheit, der das auf den Dienst Gottes und des Menschen hingeordnete menschliche Schaffen in ein Werkzeug der Sünde verkehrt.“ (Gaudium et spes 37). Auch in diesem Sinne verwendet der Jakobusbrief den Begriff:
„Wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist?“ (Jak 4,4).
Die Spannung zwischen diesen beiden Bedeutungen der „Welt“ ist auf jeder Ebene der menschlichen Existenz am Werk. Gaudium et spes stellt fest, dass sich „das ganze Leben der Menschen, das einzelne wie das kollektive, als Kampf darstellt, und zwar als einen dramatischen, zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Finsternis“ (Nr. 13). Daher muss sich die Kirche bewusst bleiben, dass ihre Botschaft der Umkehr und des Heils nicht von allen geschätzt wird. Wir müssen bereit sein, missverstanden, verspottet, verunglimpft zu werden. Unser Herr hat uns gewarnt: „Weh, wenn euch alle Menschen loben. Denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht“ (Lk 6,26). Dabei folgen wir den Fußstapfen unseres Herrn: „Ein Jünger steht nicht über seinem Meister und ein Sklave nicht über seinem Herrn. Der Jünger muss sich damit begnügen, dass es ihm geht wie seinem Meister, und der Sklave, dass es ihm geht wie seinem Herrn. Wenn man schon den Herrn des Hauses Beelzebul nennt, dann erst recht seine Hausgenossen!“ (Mt 10,24-25; vgl. Joh 15,18).
Gleichzeitig muss die Kirche ihrem König gehorchen, der uns gelehrt hat, unsere Feinde zu lieben und für diejenigen zu beten, die uns verfolgen (Mt 5,44). Der Kampf der „streitenden Kirche“ ist ein Kampf für jeden Menschen, für den der Erlöser sein Blut vergossen hat. Es ist der Kampf, die Liebe zu empfangen und zu zeigen, die Gott in Christus offenbart hat: „Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen auch wir einander lieben“ (1 Joh 4,11). In der Nächstenliebe „kämpft“ die Kirche nicht gegen menschliche Gegner, sondern gegen die Lügen des Bösen, gegen die Sünde, zu der er uns verführt, und gegen die Spaltungen, die er sät (vgl. 2 Kor 10,3-5; Eph 6,10-17; 1 Petr 2,11).
Nun ermutigt uns die reiche Tradition des Dialogs mit der Welt und der kirchlichen Inkulturation, die wir im Laufe der Jahrhunderte finden und die im II. Vatikanischen Konzil und im jüngsten päpstlichen Lehramt kraftvoll artikuliert und entwickelt wurde, dazu, dieses dynamische Verständnis der „Welt“ und der Beziehung der Kirche zu ihr zu bewahren. Wir müssen auf die „Zeichen der Zeit“ achten und den vielen Stimmen, die von außerhalb der kirchlichen Gemeinschaft zu uns sprechen, wohlwollend zuhören. Gleichzeitig müssen wir in unserer Überzeugung, dass der gekreuzigte und auferstandene Christus die einzige Quelle der Rettung ist, zuversichtlich bleiben. Er ist „der Schlüssel, der Mittelpunkt und das Ziel der ganzen Menschheitsgeschichte“ (Gaudium et spes 10). Die Kirche muss demütig die Kritik der Welt akzeptieren und bereuen, wenn sie ihrer eigenen Lehre nicht gerecht wird, wie im Fall der Skandale um den sexuellen Missbrauch. Aber sie muss auch bereit sein, der Verachtung der Welt für ihre Treue zum Wort Gottes auszuhalten. Sie soll sich nicht der Welt anpassen, sondern als Sauerteig ihr dienen (Gaudium et spes Nr. 40). Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt, gesandt in die Welt, die von Jesus in der Wahrheit geheiligt wurde (Joh 15,18-19; 17,15-19).
Ist diese gespannte Dynamik im Grundtext der Synodenversammlung zu finden? Eine aufmerksame Lektüre des Grundtextes in seiner Gesamtheit macht es schwierig, die Schlussfolgerung zu vermeiden, dass die Synodalversammlung hofft, eine Kirche herbeizuführen, die, weit davon entfernt, die Verachtung der Welt für ihre Treue zu Christus zu erleiden, und die in erster Linie von der Welt beeinflusst und von ihr bequem als eine anerkannte Institution unter anderen akzeptiert wird. Die Kirche scheint nach Ansicht der Versammlung „dem Anspruch des Evangeliums und den Standards einer pluralen, offenen Gesellschaft in einem demokratischen Rechtsstaat“ gleichermaßen verpflichtet zu sein (Grundtext, S. 2; Hervorhebung hinzugefügt). Einerseits wird „der Anspruch des Evangeliums“ nie genau festgelegt. Andererseits fordert der Grundtext, dass die Kirche und ihre Botschaft an „den Standards“ des saeculums, der modernen Welt, gemessen werden, deren „aufgeklärte und plurale Gesellschaft“ (Grundtext, S. 9) das Dokument mit ungetrübter Begeisterung umarmt.
Zwar stellt der Text fest, dass „Inkulturation ... keine Einbahnstraße“ ist, dass die „Kirche ... immer auch einen prophetisch-kritischen Auftrag ihren gesellschaftlichen Partnern gegenüber“ hat, dass „die Zeichen der Zeit ... im Licht des Evangeliums zu deuten“ sind und dass „[e]ine unkritische Aufnahme zeitgenössischer Standards ... ebenso einseitig [wäre] wie deren pauschale Abwehr“ (Grundtext, S. 2–3, 11). Ungeachtet dieser Eingeständnisse zeigt der Grundtext jedoch praktisch keine Wertschätzung dafür, wie die spezifischen Forderungen des Evangeliums, wie sie von der Kirche im Glauben und in der Nächstenliebe verkündet werden, den scharfen Widerstand hervorrufen können und es auch tun, den das Neue Testament konsequent zwischen dem Geist der Welt und der Treue zu Jesus Christus aufstellt. Darüber hinaus ignoriert der Text den Anspruch der Jüngerschaft, wie ihn Christus im Evangelium artikuliert hat.
VI. Die Kirche und das Wort Gottes
Wenn Jesus für die Apostel zu seinem Vater betet, verbindet er die Ablehnung, der sie begegnen werden, mit der Botschaft, die er ihnen anvertraut hat: „Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin“ (Joh 17,14). Damit die Nachfolger Christi festes Vertrauen in das „Wort“ haben können, das ihnen der Vater durch Christus anvertraut hat, hat der Heilige Geist es treu in der Kirche bewahrt. „Was Gott zum Heil aller Völker geoffenbart hatte, das sollte – so hat er in Güte verfügt – für alle Zeiten unversehrt erhalten bleiben und allen Geschlechtern weitergegeben werden“ (Dei Verbum 7; Hervorhebung hinzugefügt). Es wird in der Heiligen Überlieferung und der Heiligen Schrift weitergegeben, die „den einen der Kirche überlassenen heiligen Schatz des Wortes Gottes“ bilden (Dei Verbum Nr. 10). Es wird vom Lehramt treu und endgültig interpretiert: „Die Aufgabe aber, das geschriebene oder überlieferte Wort Gottes verbindlich zu erklären, ist nur dem lebendigen Lehramt der Kirche anvertraut, dessen Vollmacht im Namen Jesu Christi ausgeübt wird“ (Dei Verbum Nr.10).
Die Synodalversammlung hingegen stellt die Rolle des Lehramtes der Kirche als eine Rolle der Dialogmoderation vor (Grundtext, S. 13–14). Diese Haltung gegenüber der Lehrvollmacht, auch der des Heiligen Vaters selbst, wurde durch die Reaktion seiner Exzellenz, Bischof Bätzing, auf die Antwort der Kongregation für die Glaubenslehre auf ein Dubium über die Möglichkeit der Segnung gleichgeschlechtlicher Beziehungen veranschaulicht. Er merkte an, „der Synodale Weg
... ist deshalb bestrebt, gerade das Thema gelingender Beziehungen in einer umfassenden Weise zu diskutieren, die auch die Notwendigkeit und die Grenzen kirchlicher Lehrentwicklung bedenkt. Die von der Glaubenskongregation heute vorgebrachten Geschichtspunkte müssen und werden selbstverständlich in diese Gespräche Eingang finden.“[3] Die Entscheidung der Glaubenskongregation, die Ausdruck des ordendlichen päpstlichen Lehramtes ist (vgl. Donum veritatis Nr. 18), fügt somit nur „Geschichtspunkte“ hinzu, die in die Erwägung der Versammlung eingehen werden. Natürlich können und sollen der Papst und die Bischöfe, was sie auch tun, auf die Stimmen der Gläubigen hören, und sich mit gläubigen Experten auf relevanten Gebieten beraten. Nichtsdestotrotz tragen die Bischöfe in Gemeinschaft mit dem Papst die Verantwortung, allein autoritativ zu lehren, „mit der Autorität Christi ausgerüstete“ (Lumen gentium Nr. 25). Das heißt keineswegs, dass die persönlichen Ansichten und Meinungen der Bischöfe die Oberhand gewinnen sollten. Das wäre eine rein weltliche Betrachtungsweise der Frage. Vielmehr sollen die Bischöfe es unterlassen, ihre eigenen Ansichten und Meinungen zu lehren. Wie der hl. Paulus dürfen sie nur das lehren, was sie auch empfangen haben (vgl. 1 Kor 15,3). Wie ihr Herr müssen sie sagen können: „Meine Lehre stammt nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat“ (Joh 7,16).
Doch die Neuinterpretation des munus docendi (Lehramt) durch den Grundtext entspricht seinem noch beunruhigenderen Bekenntnis zu einem expliziten, radikalen Relativismus der Lehre:
Auch für sie gibt es nicht die eine Zentralperspektive, nicht die eine Wahrheit der religiösen, sittlichen und politischen Weltbewährung und nicht die eine Denkform, die den Anspruch auf Letztautorität erheben kann. Auch in der Kirche können legitime Anschauungen und Lebensentwürfe sogar bei Kernüberzeugungen miteinander konkurrieren. Ja, sie können sogar zugleich den jeweils theologisch gerechtfertigten Anspruch auf Wahrheit, Richtigkeit, Verständlichkeit und Redlichkeit erheben und trotzdem in der Aussage oder in der Sprache widersprüchlich zueinander sein. (Grundtext, S. 14; Hervorhebung hinzugefügt)
Dies ist ein bemerkenswerter Anspruch, wenn auch nur wegen seiner Unverständlichkeit. Man weiß nicht recht, wie man dies kommentieren soll, denn eine solche offene Ablehnung des Gesetzes des Nichtwiderspruchs ist bereits seine eigene reductio ad absurdum. Trotz Lippenbekenntnissen zur Autorität der Schrift und der Tradition (Grundtext, S. 11–12) ist es offensichtlich, dass der Interpretationsansatz der Synodalversammlung formbar genug ist, um ihnen jeden wirklich entscheidenden Inhalt zu nehmen. Die göttliche Offenbarung wird so in einer endlos sich wechselnden Hermeneutik des „Dialogs“ gefangen gehalten (siehe Grundtext, S. 37), die dem authentischen Dialogverständnis des II. Vatikanischen Konzils gegenübersteht, das von den nachkonziliaren Päpsten weitergeführt wurde (siehe insbesondere Hl. Paul VI., Ecclesiam Suam, Kap. 3). Doch trotz der Absolutsetzung des Prozesses, die ihrer Darstellung des „Dialogs“ mit sich bringt, sieht sich die Versammlung nicht nur kompetent, sondern verpflichtet, verbindliche Entscheidungen für die Kirche zu treffen (Grundtext, S. 31), indem sie sich über die „Diskursblockaden“ derjenigen hinwegsetzt, die sich ihren Urteilen widersetzen könnten (Grundtext, S. 15).
Am Ende lässt uns die Synodenversammlung fragen: Hat Gott zu seinem Volk gesprochen oder hat er es nicht getan? Die dogmatische Tradition der katholischen Kirche, die vom Zweiten Vatikanischen Konzil so eindringlich zum Ausdruck gebracht wurde, lässt keinen Raum für Zweifel. Gott hat wirklich zu seinem Volk gesprochen. Seine Rede hat sich in der Menschwerdung seines ewigen Wortes – „Christus der Herr, in dem die ganze Offenbarung des höchsten Gottes sich vollendet“ – erfüllt (Dei Verbum Nr. 7). Diese Offenbarung wurde zuverlässig – „unversehrt“ (Dei Verbum Nr. 7, 9) – in Schrift und Tradition weitergegeben. Gott hat für diese glaubwürdige Bewahrung des Evangeliums gesorgt, um die Kohärenz seiner errettenden Offenbarung zu bewahren. Papst Franziskus erklärt: „Da der Glaube einer ist, muss er in seiner ganzen Reinheit und Unversehrtheit bekannt werden. Gerade weil alle Glaubensartikel in Einheit verbunden sind, bedeutet, einen von ihnen zu leugnen, selbst von denen, die weniger wichtig zu sein scheinen, gleichsam dem Ganzen zu schaden“ (Lumen fidei Nr. 48).
Wie bereits ausführlich dargestellt, hält das Zweite Vatikanische Konzil unmissverständlich daran fest, dass diese Weitergabe der göttlichen Offenbarung durch die Sukzession der Bischöfe von den Aposteln her gewährleistet ist, über die der Herr Jesus „den heiligen Petrus ... gestellt und in ihm ein immerwährendes und sichtbares Prinzip und Fundament der Glaubenseinheit und der Gemeinschaft eingesetzt“ hat (Lumen gentium Nr. 18). Weit davon entfernt ist demnach die Meinung, dass es keine „Zentralperspektive“ des christlichen Glaubens gibt. Der Lehre des Nachfolgers des Petrus ist von allen Gläubigen mit „religiösem Gehorsam des Verstandes und des Willens“ zu folgen (Lumen gentium Nr. 25). Es ist schwierig, einen Hinweis auf eine solche Unterwerfung im Grundtext zu erkennen.
Weit davon entfernt, das päpstliche Lehramt als Quelle der „Diskursblockade“ zu sehen, erkennt es die Kirche als kostbares Geschenk des Bräutigams der Kirche an, in dessen Namen der Heilige Vater als sein Stellvertreter spricht. Mit den Worten von Papst Franziskus: „Der Nachfolger Petri ist ja gestern, heute und morgen immer aufgerufen, „die Brüder zu stärken“ in jenem unermesslichen Gut des Glaubens, das Gott jedem Menschen als Licht für seinen Weg schenkt“ (Lumen fidei Nr. 7). Das päpstliche Lehramt als solches ist nicht das „unschätzbare Gut“; vielmehr ist der Schatz Gottes Wort, wie es in der Schrift und in der Tradition weitergegeben wird. Diese treue Weitergabe ist der Zweck des päpstlichen Lehramtes, aber die Synodalversammlung stellt in Frage, ob es der Kirche (einschließlich des päpstlichen Lehramtes im Laufe der Jahrhunderte) tatsächlich gelungen ist, das Wort Gottes treu zu bewahren und zu lehren.
VII. Der gekreuzigte Christus, unsere erste Liebe
Kurz nach seiner Wahl sprach Papst Franziskus in seiner Predigt vor den Kardinälen in der Sixtinischen Kapelle (14. März 2013) wie folgt:
Wir können gehen, wie weit wir wollen, wir können vieles aufbauen, aber wenn wir nicht Jesus Christus bekennen, geht die Sache nicht. Wir werden eine wohltätige NGO, aber nicht die Kirche, die Braut Christi. ...
Das Evangelium fährt mit einer besonderen Situation fort. Derselbe Petrus, der Jesus Christus bekannt hat, sagt zu ihm: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ich folge dir, aber sprich mir nicht vom Kreuz. Das tut nichts zur Sache. Ich folge dir mit anderen Möglichkeiten, ohne das Kreuz. – Wenn wir ohne das Kreuz gehen, wenn wir ohne das Kreuz aufbauen und Christus ohne Kreuz bekennen, sind wir nicht Jünger des Herrn: Wir sind weltlich, wir sind Bischöfe, Priester, Kardinäle, Päpste, aber nicht Jünger des Herrn.
Ich möchte, dass nach diesen Tagen der Gnade wir alle den Mut haben, wirklich den Mut, in der Gegenwart des Herrn zu gehen mit dem Kreuz des Herrn; die Kirche aufzubauen auf dem Blut des Herrn, das er am Kreuz vergossen hat; und den einzigen Ruhm zu bekennen: Christus den Gekreuzigten. Und so wird die Kirche voranschreiten.
Meine Brüder, abschließend, empfehle ich diesen Brief und diese Fragen unserem Gebet und unserem Nachdenken. Sind wir bereit, vom Kreuz zu sprechen? Haben wir den Mut, den Weg des Kreuzes zu gehen und die Verachtung der Welt aufgrund der Botschaft des Evangeliums zu ertragen? Werden wir selbst den Ruf des Herrn Jesus zur Umkehr beherzigen und den Mut haben, ihn in einer ungläubigen Welt zu verkünden? Schämen wir uns „nicht für das Evangelium“ (Röm 1,16) und seinem Angebot der Freiheit von der Sünde durch den Tod und die Auferstehung Christi und einer innigen Beziehung zu seinem Vater in der Liebe seines Heiligen Geistes? Werden wir am Weinstock, Jesus Christus, bleiben und Früchte tragen, oder werden wir weiter verdorren (Joh 15,5-6)?
Haben wir, wie die Kirche in Ephesus, zu der der auferstandene Jesus spricht, „die erste Liebe verlassen, die wir hatten“ (Offb 2,4)? Wenn dem so ist, so sollen wir die Ermahnung und Warnung des Herrschers der Könige der Erde hören: „Bedenke, aus welcher Höhe du gefallen bist! Kehr zurück zu deinen ersten Taten! Wenn du nicht umkehrst, werde ich zu dir kommen und deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken“ (Offb 2,5; vgl. 1,5). Meine Brüder, erinnern wir uns an den gekreuzigten Christus. Erinnern wir uns an unsere erste Liebe.
In der Liebe Jesu Christi,
+Samuel J. Aquila
Erzbischof von Denver
13. Mai 2021
Christi Himmelfahrt
______________________
[1] Das Grundtext wurde online unter https://www.synodalerweg.de/fileadmin/Synodalerweg/Dokumente_Reden_ Beitraege/Online-Konferenz-210104-2-Synodalforum-I-Grundtext-1.pdf (abgerufen am 18. März 2021).
[2] Robert Louis Wilken, Die ersten tausend Jahre: Eine globale Geschichte des Christentums (New Haven, CT: Yale
University Press, 2012), 356–57; Hervorhebung hinzugefügt
[3] https://www.dbk.de/presse/aktuelles/meldung/bischof-baetzing-zur-heutigen-veroeffentlichung-der-kongregation- fuer-die-glaubenslehre (abgerufen am 15. März 2021).