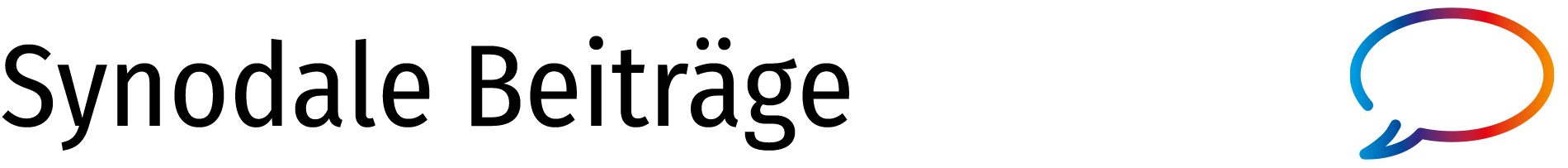11. Oktober 2021 | Wie finden Glaubende den "gemeinsamen Weg"?
Autor: Paul Josef Kardinal Cordes
Quelle: Bislang unveröffentlicht
In den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts verfasste der Rheinländer Joseph Mohr den Text des Liedes: „Ein Haus voll Glorie schauet weit über alle Land.“ Es drängte den Jesuitenpater offenbar, inmitten von Bismarcks Kulturkampf die Größe der katholischen Kirche bewusst zu machen und Begeisterung für sie zu wecken. Wer in unseren Tagen sensibel ist für das Kirchenklima, dürfte sich wohl kaum zu einer solchen Hymne aufschwingen. Kirche ist uns Katholiken weit über Deutschland hinaus stattdessen zu einer Last geworden. „Glaube ja, Kirche nein!“, formulieren die Enttäuschten. Und weil Kirchenglieder an ihrer Unverzichtbarkeit festhalten, drückt sie große Sorge.
Die Synode: eine erste Rettungsidee
In jüngerer Vergangenheit versuchten nach dem Vatikanum II in einigen europäischen Ländern unterschiedlich strukturierte kirchliche Erneuerungsorganen, pastorale Impulse zu wecken. Die Deutschen Bischöfe wurden nach dem Katholikentag 1968 gedrängt, die „Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland“ (1972-1975) einzuberufen. Sie sollte die Diözesen dieses Landes aus der Kirchenkrise führen Der spätere Kardinal Karl Lehmann (+ 2018) hat sie ausführlich dokumentiert. In der sehr detaillierten „Einleitung“ legt er dar, dass der Begriff „Synode“ schon seit der frühen Christenheit in Gebrauch war, sich aber immer wieder wandelte. Im Synoden-Begriff schlug sich nämlich je neu auch das jeweilig herrschende Zivilmodell für öffentliche Foren und das gesellschaftspolitische Umfeld nieder. (Anm. K. Lehmann, Allgemeine Einleitung, in Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland, Beschlüsse ((=WS)), Freiburg 1976, 21-67, hier 24ff.)
Nun hat für unsere Tage in der katholischen Kirche die Idee der Synodalität allerhöchste Aktualität bekommen. Es war Papst Franziskus selbst, der sie in seinem Pontifikat wieder und wieder lancierte. Die Initiativen des Papstes und ihre weite kirchliche Resonanz sind Grund genug, der gegenwärtigen Verwendung von Begriff und Sache „Synode“ spezifische Aufmerksamkeit zu widmen.
Päpstliche Vorgabe: Überblick
In einer Ansprache anlässlich des 50. Jubiläums der Bischofssynoden (17.10.2015) gestand Papst Franziskus, die synodale Idee „aufzuwerten“ sei schon von Beginn seines Pontifikats seine Absicht gewesen und umriss seine Vorstellung von Synode näherhin. Er stellte die theologische Wahrheit heraus, dass die Gesamtheit der Gläubigen im Glauben nicht irren könne. Glaubenswahrheit sei demnach vom Volk Gottes zu erfragen. Folglich sei eine synodale Kirche „eine Kirche des Zuhörens,“ des „wechselseitigen Anhörens, bei dem jeder etwas zu lernen hat: das gläubige Volk, das Bischofskollegium, der Bischof von Rom“.
Inzwischen hat Papst Franziskus nun die Synodalität zum Thema eines großen Beratungsprozesses der weltweiten Catholica gemacht. Der Vatikan veröffentlichte ein Vorbereitungsdokument „Für eine synodale Kirche: Gemeinschaft, Teilhabe und Sendung“ (= GTS) sowie ein Handbuch (am 7.9.2021). Die Texte definieren Synodalität als „die Form, den Stil und die Struktur der Kirche“. Ihr Zusammentreten will der „Qualität des kirchlichen Lebens und die Ausübung der evangelisierenden Sendung“ fördern. Niemand darf bei den Beratungen ausgeschlossen sein, und es soll „jedem - besonders denen, die sich aus verschiedenen Gründen an den Rändern befinden - Gelegenheit geben werden, das Wort zu ergreifen und angehört zu werden“. Ausdrücklich geht es auch um Äußerungen „anderer Kirchen und christlicher Gemeinschaften“. Ja „die Perspektive des ‚gemeinsamen Gehens‘“ soll „die ganze Menschheit umgreifen“.
Als zweites Charakteristikum der Synodalität erscheint die „Gemeinsamkeit des Unterwegsseins“. Denn die Erfahrung authentischen Zuhörens und der Unterscheidung zeige „den Weg, Kirche zu werden, zu der Gott uns ruft“. So ereigne sich - drittens - eine fruchtbare Verbindung zwischen dem sensus fidei des Volkes Gottes und der Amtsfunktion der Hirten als einstimmiger Konsens der ganzen Kirche im gleichen Glauben. Das kirchliche Lehramt habe ja immer - viertens - bei der „Definition der dogmatischen Wahrheiten“ auf die „Autorität des sensus fidei des ganzen Gottesvolkes zurückgegriffen, der ‚in credendo unfehlbar ist‘“ (GTS 11). In all dem sei - schließlich - die synodale Kirche eine Kirche „im Aufbruch“, eine missionarische Kirche, «mit offenen Türen», wenn auch die Konsultation des Volkes Gottes keine demokratisierende Dynamik impliziere, die nämlich auf dem Mehrheitsprinzip basiert.
Dieser päpstliche Einstieg in Selbstverständnis und Sendung der Kirche kann nicht anders als epochal bezeichnet werden. Sein unverkennbarer Hauptakzent liegt darin, dass im Volk Gottes Geschlossenheit des Vorrückens erreicht werden soll. Dabei gilt ein besonderes Augenmerk der kirchlichen „Peripherie“. In einem Brief zum hundertsten Jahrestag der Theologischen Fakultät von Buenos Aires (1.9.2015) schrieb der Papst: „Die Randgebiete sind keine Optionen, sondern notwendig für ein größeres Glaubensverständnis… Wir dürfen nicht vergessen, dass der Heilige Geist im betenden Volk das Subjekt der Theologie ist.“ Eben alle sollen beitragen zu einem gemeinsamen Start aller, damit die Synode zum Resonanzboden der kompletten Kirchengemeinschaft wird.
In den genannten amtlichen Texten wird mit der Erwähnung „Glaube“ zwar das eigentlich kennzeichnende Element des kirchlichen Auftrags angesprochen. Doch auf dessen zeittypische Entstellung, Unterdrückung oder Leugnung fehlen alle Hinweise. Das „Hören auf den heiligen Geist“ scheint problemlos gesichert. Doch die Geißeln unserer Tage sind ja nicht nur Pädophilie, Pandemie und Machtmissbrauch. Glaubensfeindlicher „Weltgeist“ zerstört gleichfalls mehr denn je die Dimension der Transzendenz und die Ehrfrucht vor dem Menschen. Sinn für Gott kann eben gegenwärtig keineswegs einfachhin vorausgesetzt werden. „Ohne Gott“ aber degenerierte der viel gepriesene „Humanismus zur Tragödie“ (Henri de Lubac).
Absicht und Ausmaß der päpstlichen Vorgabe legen es fraglos nahe, seine skizzierten synodalen Ordnungslinien durchzusehen und evt. mit bereits vorliegenden Erfahrungen sowie zusätzlichen theologischen Überlegungen weiter zu erhellen.
Die „Würzburger Synode“: Mitglieder und Influenzer
Ganz offenbar soll die anstehende „Weltsynode“ bei einer umfassenden Bestandsaufnahme von Sein und Denken der Menschheit heute beginnen. Mehrfach betonen die päpstlichen Anweisungen, die Gesellschaftsanalyse und der Religionsbefund dürften keinerlei Schranken unterworfen werden. Keine Tür bleibe verschlossen; andere Konfessionen, Religionen, die Zivilgesellschaft und Zusammenschlüsse aller Art seien zu hören. Der „Ist-Zustand“ sei realistisch zu erheben.
Eine Reihe solcher Elemente, die somit auf eine Synode Einfluss nehmen sollen, hatte K. Lehmann in seinem zitierten Beitrag (WS) aufgelistet. Er benennt zunächst die offiziellen Kirchenglieder, Priester, Ordensleute und Laien. Dann erwähnt er auch „31 Gruppen zur kritischen Begleitung“, die sich zur „Arbeitsgemeinschaft Synode“ zusammengeschlossen haben, u. a. „Freckenhorster Kreis“, „Bensberger Kreis“, „Frankfurter Kreis“. Als erkennbar relevante Kraft der Beratungen erwies sich ferner die „öffentliche Diskussion“ in den Medien. Sie schlug sich zur Frage der synodalen Mitgliedschaft, zur Verbindlichkeit ihrer Beschlüsse und zu allen Sachthemen nieder. Schon bald wurde darum ein synodales Büro zur „Öffentlichkeitsarbeit“ gebildet.
Schließlich startete die Bischofskonferenz eine selten aufwendige „Umfrageaktion“. Fachsoziologen und das renommierte Umfrage-Institut „Allensbach“ führten Repräsentativsondierungen durch, die - nach Kennern - eine „Datenmasse erbrachte, die auf religionssoziologischem Gebiet ohne Beispiel ist“. Sie sollte die Trends und Bewegungsgesetze der Gesellschaft erheben und gleichzeitig der innerkirchlichen Bewusstseinsbildung dienen.
Soweit ein knapper Abriss der gedanklichen Materie, die die Würzburger Synode inspirieren sollte. Sie alle dienten nach K. Lehmann dem Ziel der: „Gemeinsamen Bewahrung des christlichen Glaubens durch Scheidung der Geister in bedrohlichen Gefahrensituationen, Vergleich und Einigung kirchlicher Überlieferungen, gemeinsame Ordnung des Lebens der Kirche, gegenseitige Hilfe bei der rechten Leitung“ (WS 23).
Auch wenn für die anvisierten Entschlüsse die „Gesetzgebungskompetenz der Bischöfe nicht bestritten“ (WS 41) wurde: Die kolossale Diversität der Eingaben, rechthaberischer Anspruch mancher Interventionen und manipulative Vorstöße der Medien kosteten sie kräftezehrenden Einsatz. Gelegentlich waren schon Fakten geschaffen worden, die theologisch-legitimer Pastoral widersprachen („vorweg-eilender Gehorsam“). Weil ich bei allen Synodensitzungen anwesend war, habe ich das Ringen der Hirten aus der Nähe miterlebt.
„Synodaler Weg“ in Deutschland: Sein Reflexionshorizont
Ca. 40 Jahre nach der „Würzburger Synode“ schreckten Sünde und Verworfenheit des Pädophilie-Skandals die Gemeinden und ihre Seelsorger auf. Die deutschen Bischöfe ließen bald von unabhängigen Universitäts-Instituten eine wissenschaftliche Analyse erarbeiten, die Studie „Sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige“ („MHG-Studie“, vorgestellt 25.9.2018). Dass diese Recherche von kirchenfremden Fachleuten durchgeführt wurde, erhöhte ihre öffentliche Reputation. Entsprechend ihrem Experten-Verständnis sahen die Empiriker die Kirche in soziologischer Perspektive. Sie empfahlen demnach Strukturveränderungen, wie sie gemeinhin einen weltlichen Sozialkörper besser funktionieren lassen. Leider verblieben die geweihten Hirten weitestgehend in dieser empirischen Sicht. Ein charakteristisches „Mehr“ der Kirche trat zurück. Die Bischöfe bemühten sich um kirchliche Image-Aufbesserung und forderten die Abkehr vom Zölibat, Entpathologisierung der Homosexualität und die Priesterweihe von Frauen. Sie reagierten mit medial Erwünschtem, nicht mit resoluten Bekehrungsrufen etwa biblischer Propheten.
Dann folgte der „Synodale Weg“. Die Deutschen Bischöfe beschlossen ihn im Frühjahr 2019 als Heilungsversuch. Verschiedenen Arbeitsgruppen („Foren“) wurde das weite Feld der kirchlichen Sendung übertragen. Wieder verschwimmt der Rang der Glaubensdimension. Das Synodenstatut unterwirft nämlich die Glaubenswahrheiten der Abstimmung der synodalen Zusammenkunft. Es unterlässt den Hinweis, dass einige Entscheidungen des höchsten kirchlichen Lehramts eben aufgrund von dessen Autorität auch ohne Rezeption durch die Gläubigen gelten.
Ein ähnliches Verkennen geistlicher Implikationen in der Sendung der Kirche führt dann zur lauten Forderung neuer kirchlicher Machtverteilung. Geweihte Hirten werden von katholischen Professoren der „Hypertrophierung des Eigenstands“ gescholten, der „Selbstsakralisierung“. Nicht nur, weil sie - Gott sei’s geklagt - fehlbare Sünder sind. Sondern weil heutige amtliche Legitimation grundsätzlich die freie Zustimmung der Betroffenen voraussetzt. Allein demokratische Akzeptanz legitimiere stattdessen alle Vollmacht. Dass hingegen Jesus Christus - nach den Evangelien - seine Apostel mit einer spezifischen EXOUSIA ausgerüstet hat; dass das Ordo-Sakrament - nach katholischer Weiheliturgie - solche bis heute den Ordinanden mitteilt, ist höchstens ärgerlich.
Zum Sinn von Synoden: Glaubensfundierung (CIC § 342)
Eine Synode ist kein Forum von Sprüchemachern, sondern hat ernsthafte geistliche Ziele. Sie dient also nicht kirchlicher Selbstbestätigung und übersteigt ferner völlig rein innerweltliche Wahrnehmung und gesellschaftliche Reflexion. Der Empirie entziehen sich eben heilsgeschichtlich-gnadenhafte Prozesse. Fraglos muss Kirche ihre pastorale Praxis im jeweiligen Zeithorizont neu durchdenken. Dazu dienen ihr ebenso medial wie soziologisch erhobene Daten. Aber die Glaubensgemeinschaft wird diese nicht verabsolutieren, um sich wie eine humanitäre „Nicht-Regierungs-Organisation“ im Gesellschaftlichen zu erschöpfen. Jesu Warnruf ist neu zu hören: „Wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde noch Glauben finden?“ (Lk 18,8).
Wer die Kirche als Element der Zivilgesellschaft proklamiert, mag Christsein mit dem Zeitgeist versöhnen. Doch er führt in die Irre. Denn er verkürzt das Vollmaß von Gottes Verheißung. Transzendente Inhalte verflüchtigen sich, wenn eine immanente Sinnprovinz über die christliche Heilsbotschaft dominiert. Glaube fordert hingegen einen Verständnis-Horizont, der sich der ganzen Wahrheit vom Menschen öffnet. Damit Gottes Offenbarung unverkürzt erkannt werden kann, sind Deutungs-Kategorien nötig, die alle Realität - nicht zuletzt die geoffenbarte - unverkürzt beachten. Die Diesseitskräfte der Natur allein genügen nicht zum Heil. „Der Glaube ist eine übernatürliche Gabe Gottes. Um zu glauben, bedarf der Mensch der inneren Hilfe des Heiligen Geistes“ (KKK 179).
Den Gott-Suchenden bewahrt der Glaubensblick davor, lediglich auf seine eigenen Kräfte zu bauen. Doch wo findet er beim Nachforschen verlässliche Orientierung? Zahlreicher als die Ärzte des Leibes sind die der Seele. Denn Gottes verbürgtes Heilswort hat in der Welt nur ein verzerrtes Echo. Es findet in den Adressaten keinen authentischen Widerhall. Unsere Sünde entstellt und verfälscht es. Der menschliche Resonanzraum ist demzufolge nie kristallklarer Spiegel der göttlichen Offenbarung. Selbst geachtete Boten trüben ihn ein. Dann aber können sich theologische Thesen und kirchlich-pastorale Impulse nicht ungeprüft Autorität zumessen. Die Geschichte erweist nicht erst durch die Pädophilie, dass die Kirche auch Ort skandalöser Verirrungen sein kann; sie war immer schon durchsetzt von Häresien und beschmutzt von Sünden.
Darum hat sorgfältige Theologie eine erwünschte „Unfehlbarkeit des ganzen Gottesvolkes in credendo“ nicht pauschal behauptet, sondern differenziert (Anm. Vgl. zum Folgenden die Studie der Internationalen Theologische Kommission: Sensus fidei und Sensus fidelium, vom 5.3.2014). Sie unterscheidet zwischen „Sensus fidei (der inhaltliche Glaubenssinn)“ und „Sensus fidelium (der Sinn der glaubenden Personen)“. Und sie hält fest: Was in der Glaubensvorstellung des Volkes Gottes greifbar wird, ist nicht schon deshalb kirchlich verbindlicher Glaube. Den zu qualifizieren, ist die Kompetenz des kirchlichen Lehramts. Dies beurteilt,
ob Meinungen, die im Gottesvolk anzutreffen sind und die der sensus fidelium zu sein scheinen, tatsächlich der Wahrheit der Tradition entsprechen, die von den Aposteln herkommt. Newman sagt dazu: „Die Gabe der Wahrnehmung, des Scharfsinns, der Definition, der Verkündigung und Verstärkung jeglichen Teils der Tradition ist allein der Ecclesia docens inne“ (Nr. 77).
So kommt denn das Urteil über die Authentizität des sensus fidelium letzten Endes weder den Gliedern des Volkes Gottes noch der Theologie zu, sondern dem Lehramt. Diese kirchliche Instanz allein hat in der Glaubensgemeinschaft das Siegel der Verlässlichkeit.
Jenseits der Zuständigkeit des Lehramtes für den sensus fidei macht die Theologische Kommission auch Angaben über mögliche individuelle Partizipation an ihm. Ein ganzes Bündel ekklesialer, spiritueller und ethischer Faktoren ist ihre Voraussetzung, u. a. ein sentire cum Ecclesia, aber auch Hören auf Gottes Wort, Heiligkeit, Demut, Freude und Streben nach dem Aufbau der Kirche (Anm. ebd. Nr. 88 – 105).
Perspektivenwechsel: der Reichtum des authentischen Erbes
Plebiszite, Referenden, Volksabstimmungen sind heute allenthalben gang und gäbe. Eine Vielzahl von Instituten führt Befragungen durch, um etwa das Wahlverhalten der Bürger zu erforschen. Bedeutende Produktionsbetriebe suchen die Wünsche der Kunden herauszufinden. Es gibt kaum eine Dimension des Menschen, zu der kein statistisches Material vorläge. So ist denn Meinungsforschung fraglos eines der beliebtesten Mittel geworden, die menschliche Lage zutreffend einzuschätzen. Dieser Trend prägt auch die Glaubensgemeinschaft und das Verständnis ihrer Dienste.
Dass die synodalen Strukturen von der frühen Christenheit an durch die jeweils herrschenden Zivilmodelle mitgeprägt sind, wurde schon erwähnt (Anm. WS aaO. 24f.) Demnach plant das „gemeinsame Gehen“ der anstehenden Synode - wie es im Vorbereitungsdokument heißt - einen kirchlichen Prozess, „an dem alle teilnehmen können und von dem niemand ausgeschlossen wird, und der jedem - besonders denen, die sich aus verschiedenen Gründen an den Rändern befinden - die Gelegenheit gibt, das Wort zu ergreifen und angehört zu werden“. Es liegt auf der Hand, dass solch unbegrenzte Befragung das Interesse an der kirchlichen Sendung im Volk Gottes und weit über dieses hinaus weckt. Ein Kaleidoskop von Hinweisen ist zu erwarten. Sie streben die „Qualität des kirchlichen Lebens und die Ausübung der evangelisierenden Sendung“ an. Ihre Vielzahl ist fraglos der Boden neuen Lebens, doch ihre Heterogenität zu vereinen wohl auch ein Mammut-Unternehmen.
Damit erhobene Antworten der Glaubensfundierung nützen, müssen sie freilich in theologisches Licht gestellt werden. Solche Unverzichtbarkeit wurde schon erkennbar, damit der „Glaubenssinn des Volkes Gottes“ nicht plebiszitär missdeutet, sondern korrekt verstanden wird. Denn nicht nur der sensus fidelium des Volkes klärt sich im Offenbarungshorizont. Es möchte sein, dass die Synodenidee als solche sich in ihm völlig neu darstellt. Nicht länger soll dann der heterogene und oft getrübte Widerhall von Gottes Botschaft in Kirche und Menschheit zu einer gewinnenden Motivation der hoch geschätzten kirchlichen Gemeinschaftlichkeit zusammengefügt werden. Der Betrachtungswinkel ändert sich. Gottes Wort kehrt den Blick von dem schwierigen Unterfangen, eine große Disparität von Stimmen in Einklang zu bringen, hin zu Gottes Offenbarung.
Solcher Wechsel der Perspektive auf Gott hin ist ebenso relevant wie faszinierend. Einmal zeigt sich, dass Gott selbst offenbar die Menschheit homogen und einträchtig will. Erst durch Abkehr von seinem Willen kamen Distanzierung, Zwietracht und Opposition zwischen uns Menschen auf. Das ganze Humanum wird so in die Sünde einbezogen. Das Buch Genesis sieht nach der Ursünde solche Folgen des Ungehorsams im Verteidigungsversuch unserer Stammeltern. Gott stellt sie zur Rede. Und Adam, der eben noch das Glück einer Gehilfin bejubelt hatte - „Das ist nun endlich Bein von meinem Bein“ -, trennt sich rasch von ihr und schiebt ihr die Schuld zu: „Die Frau, die du mir beigesellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben“. Ebenso zerbricht die Frau die Harmonie, die sie zunächst in der Schöpfung barg; sie denunziert die Schlange: „Die Schlange hat mich verführt, und so habe ich gegessen“ (Gen 3,12f.).
Noch eine andere alttestamentliche Erzählung erklärt das Zerbrechen der menschlichen Gemeinschaft durch Gottwidrigkeit: der Turmbau zu Babel. (Gen 11, 1- 9). Diesmal knüpft die Begründung bei menschlicher Sprachfähigkeit an. Titanischer Wille soll der Menschheit Autonomie geben; diese will ihre kreatürliche Unterordnung abschütteln und „einen Turm bauen mit einer Spitze bis zum Himmel“. Auf diese Weise gedenkt sie, sich „einen Namen zu machen“. Doch Gott zügelt ihren Hochmut. Er steigt herab und verwirrt „ihre Sprache, so dass sie nicht mehr die Sprache des andern verstehen“. Durch unbegreifbare Redeweise zerfällt Gemeinschaft in Verständnislosigkeit und gegenseitige Resistenz.
Doch die Heilige Schrift beschränkt sich nicht darauf, uns Menschen vor Entzweiung zu warnen. Sie lehrt auch sie zu überwinden. Ja, sie offenbart uns sogar die primäre Quelle aller Einheit; denn sie schenkt uns das Selbstbildnis des dreifaltigen Gottes. In der urchristlichen Theologie über die Trinität leuchtet Einheit; im Dreifaltigen ist sie wiederzuentdecken. Die Schönheit dessen, was Gott über sich selbst preisgibt, kann packen und für ihn einnehmen. Und weil er in sich Einhelligkeit in Reinform ist, findet Gottes Volk zur Gemeinschaft genau in dem Maß, in dem es sich Gott naht.
Der erste Johannesbrief: Gott selbst als Urgrund unserer Erlösung
Im Neuen Testament sichert vor allem die johanneische Theologie den Glaubenden Gemeinschaftlichkeit zu, eine KOINONIA/Communio, die von Gott kommt. In unterschiedlicher Weise und mit wechselnden Ausdrücken verbürgt sich der Verfasser des 1. Johannesbriefes, dass Glaube mit der Teilnahme am Leben Gottes beschenkt. Der Hörer wird einbezogen in die Gemeinschaft, die der Briefverfasser selbst „mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus“ hat (1 Joh 1.3). Ethische Verpflichtungen (1 Joh 2,6), das Halten der Gebote (1 Joh 3.24), das Bekenntnis zu Jesus Christus (1 Joh 4,15) und das Bleiben in der Liebe (1 Joh 4,16b) gründen in dieser KOINONIA mit Gott. Die Adressaten des Briefes treten durch Christus in einen tiefen Seins- und Lebensbezug mit Gott - auch wenn die volle Union mit ihm noch aussteht.
Anders als in der gnostischen Irrlehre, die die Materie verachtete und Gott-Einung in einer weltlosen Sphäre des Lichtes sucht, macht johanneische Theologie diese KOINONIA im geschichtlichen Menschen fest. Der ewige und allmächtige Schöpfer bindet sich an seine Kreatur. Wir sind in Gott, und er ist in uns. Wieder und wieder sichert der 1. Johannesbrief die Gegenseitigkeit dieser Beziehung zu. „Wir haben Gemeinschaft mit dem Vater“ (1 Joh 1,3.6). Gerechtigkeit zu tun, ist der Ausweis, dass jemand „von Gott stammt“ (1 Joh 2,29). Wir „sind in ihm“ (1 Joh 2,5); „wir sind in diesem Wahren“ (1 Joh 5,20). Nicht von Hinüberwechseln in ferne und ungreifbare Transzendenz ist in Gottes Wort die Rede, sondern von lebensnaher gegenseitiger Reziprozität. Des himmlischen Vaters Zusage schafft Realität: „Seht, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat: Wir heißen Kinder Gottes, und wir sind es“ (1 Joh 3,1). Weil wir aus Gott stammen, können wir der Welt widerstehen: „Alles, was aus Gott stammt, besiegt die Welt“ (1 Joh 5, 4). Doch trotz gegenseitigen Durchdringens bleiben die Personalität Gottes und die des Menschen unangetastet; die Grenze zwischen Schöpfer und Geschöpf wird nicht verwischt. Wer „von Gott stammt“ (1 Joh 3,9), wird nicht selbst zu Gott, doch ihm definitiv verbunden.
„Gesicht“: ein trinitarisches Interpretament
Der 1. Johannesbrief lehrt nicht nur eine faktische Zugehörigkeit zu Gott, sondern die Gemeinschaft mit ihm hat auch eine Erkenntnisdimension: „Ich schreibe euch, ihr Väter, dass ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist“ (1 Joh 2,13); „wer sündigt, hat ihn nicht gesehen und ihn nicht erkannt“ (1 Joh 3,6). Wenn der Autor so das Gott-Erkennen anspricht, tritt für das synodale Engagement leider ein blinder Fleck zutage: Gott interessiert in der Synode offenbar nur noch in seinem Handeln und Wollen. Was er über sich selbst offenbart, bleibt unbeachtet. Die frühen Kirchenväter sind vergessen. Ihnen war Gottes Selbsterschließung kostbar, und sie suchten das Geheimnis der Dreifaltigkeit in Worte zu fassen. Der Ausdruck „Gesicht“ oder „Person“ (PROSOPON) erscheint ihnen als Hilfe. Immer neu richteten diese Gottsucher ihren Blick auf die Dreipersönlichkeit Gottes (Anm. Vgl. zum Folgenden P.J.Cordes, Communio – Utopie oder Programm? Quaestiones Disputatae 148, Freiburg 1993, 147 – 156. Hier auch die Angaben zu den Fundstellen.).
Ihr Wollen und Denken folgt der neutestamentlichen Offenbarung und wendete sich den „Gesichtern“ zu. Diese Gesichter bekommen im Beschreiben des Zueinander der Personen oder Hypostasen gewinnende Umrisse. Die Forscher wollten nicht nur die Wahrheit des rechten Glaubens verteidigen, sondern auch zur Intimität des trinitarischen Lebens vordringen, weil das Wunder und Geheimnis geliebter Personen erwärmt und anzieht. Um den Gemeinschaftsaspekt der Dreifaltigkeit hervor zu heben, umkreisen die Theologen überwiegend ihre KOINONIA.
Für Athanasius (+ 373) etwa zeugt Gott nicht den Sohn, indem er sich von diesem trenne, so dass er selbst noch Vater eines zweiten Sohnes sein könnte; seine Vaterschaft bleibt an den Sohn gebunden. In gleicher Weise zeuge auch der Sohn niemanden, sondern werde ganz davon erfasst, das Bild und der Glanz des Vaters zu sein. „Der Vater war immer Vater - wie der Sohn immer Sohn war. Auch für alle Zukunft wird der Vater niemals Sohn sein, wie der Sohn niemals Vater sein wird.“
Basilius der Große (+ 379) ringt bei der Unterscheidung der Hypostasen um Worte und Vergleiche für „das Maßlose, das nicht verstanden werden kann; das vor aller Schöpfung ist; das nirgendwo je beschrieben wurde und das im Vergleich mit aller belebten Natur unvergleichlich ist“. Angerührt und anrührend ruft Clemens von Alexandrien (+ vor 216) aus: „0 großer Gott! 0 vollkommener Sohn! Der Sohn ist im Vater und der Vater im Sohn.“ Und Johannes Damaszenus (+ 749) formuliert in theologischer Dichte die Bindung von Vater, Sohn und Heiligem Geist aneinander und ihre gegenseitige Verschiedenheit: „Die Bleibe und der Sitz jeder Person ist in der anderen.“
In all den Überlegungen hat der Gemeinschaftsbegriff nicht nur einen sachlichen Inhalt, sondern auch eine personale Färbung: Athanasius versichert die Nähe des Sohnes zum Vater und deutet zu diesem Zweck den Vaternamen: Schon in diesem Namen sei mitgegeben, dass der Träger der Ursprung der Verbindung mit dem Sohn sei.
Wie der Vater nicht vom Sohn, so kann auch der Sohn nicht vom Vater getrennt werden; denn das Wort Vater deutet aus sich heraus auf Gemeinschaft. In beider Hände aber ist der Heilige Geist, der weder vom Sendenden noch vom Überbringer getrennt werden kann.
In der theologischen Auseinandersetzung um die Wesensgleichheit des Sohnes mit dem Vater versichert Basilius der Große gegen den Arianer Eunomius (+ 395) des Sohnes Teilhabe am Vater, das heißt seine „KOINONIA mit dem Vater“. In seinem Werk über den Heiligen Geist versichert er dann dessen Gemeinschaft zwischen Vater und Sohn. Diese Gemeinschaft beruhe, wie er an anderer Stelle sagt, nicht auf „blindem Zufall", sondern „auf der Gemeinschaft der Natur“.
Trinitätstheologie: Impuls zu Anbetung und Beseligung
Die trinitarischen Streitigkeiten zwingen die Theologen immer wieder, die gleiche Würde der göttlichen Personen zu bekennen. Nicht nur Korrektheit des Glaubens, auch Gottes Anbetung und das Glück seiner Gemeinschaft motivieren sie. Sie sind ergriffen: Wer immer diesem Gott naht, bleibt nicht selbstverschlossen. Er geht aus sich heraus; es drängt ihn, dass Gottes Größe anerkannt wird. Basilius schreibt zu den Eingangsversen von Psalm 109, die Gegner der Gottessohnschaft Jesu „rauben dem Sohn die Gemeinschaft der Ehrenbezeugung mit dem Vater“. Christi Taufbefehl kommentiert er: Die öffentliche Kundgabe des Herrn, alle Völker im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes zu taufen, lehre auch die gleiche Würde der drei göttlichen Personen.
Auch seinen jüngeren Bruder Gregor von Nyssa (+ 395) treibt Gottes Größe und Glorie:
Siehst du die Kreisbewegung der gegenseitigen Verherrlichung der Gleichen? Der Sohn wird verherrlicht durch den Geist, der Vater wird verherrlicht durch den Sohn. Seinerseits empfängt der Sohn die Verherrlichung durch den Vater, und die Verherrlichung des Geistes ist der Eingeborene.
Johannes Chrysostomus (+ 407) greift diesen Gedanken auf, und in seiner Formulierung schlägt sich erneut nieder, dass diese Theologen nicht nüchterne theologische Sachaussagen formulieren, sondern zu Gottes Bewunderung und Würdigung bewegen wollten. Ein hochaktuelles Bestreben: Wer Gottes-Glaube stumm voraussetzt, versäumt die ihm zukommende Verehrung. Der Erzbischof von Konstantinopel spricht an anderer Stelle die Trinitätsanrufung bei der Taufspendung an: Um Gottes Dreifaltigkeit zu wissen, sei ein großes Geschenk, dessen unaussprechliche Güter zu rühmen wären.
Der noch nicht genannte dritte Kappadozier, Gregor von Nazianz (+ 390), bekennt, was ihn innerlich erfüllt und geistlich überwältigt, wenn er sich anbetend in dieses Geheimnis versenkt:
Noch habe ich nicht begonnen, die Einheit zu bedenken, und schon überflutet mich die Dreieinigkeit mit ihrem Glanz. Noch habe ich nicht begonnen, die Dreieinigkeit zu bedenken, und schon hat mich wieder die Einheit hin weggerissen. Wenn Einer der Drei sich mir vorstellt, denke ich, es sei das Ganze, so sehr ist mein Auge erfüllt, so sehr entgleitet mir die Überfülle; denn in meinem Geist, der allzu begrenzt ist, um einen Einzigen der Drei zu begreifen, bleibt kein Raum mehr für die beiden Andern. Und wenn ich die Drei in einem einzigen Gedanken fasse, sehe ich eine einzige Flamme, bin unfähig, das geeinte Licht zu trennen oder zu erforschen.
Es war der hochgelehrte Clemens von Alexandrien (+ vor 215), der als einer der ersten den Enthusiasmus des frühchristlichen Anfangs formulierte:
„Kostet und seht, wie gut der Herr ist!“ Der Glaube wird euch herführen, die Erfahrung euch lehren, die Schrift euch erziehen. „Kommt, ihr Kinder“, sagt sie, „hört mir zu! Ich will euch in der Furcht des Herrn unterweisen.“ Dann fragt sie, da sie zu solchen spricht, die schon zum Glauben gekommen sind, an: „Wer ist der Mensch, der sich nach Leben sehnt und gute Tage zu sehen wünscht?“ - Das sind wir, ist unsere Antwort, wir verehren das Gut, wir eifern um die Güter… Eilen wir also, eilen wir, uns zu vereinen im Heil, in der neuen Geburt; in der einen Liebe - wir, die wir viele sind - nach dem Vorbild jener Einigkeit, die im einzigen Wesen Gottes herrscht. Weil er uns das Gute gewährt, wollen wir unsererseits Einheit stiften und uns an der guten Ureinheit festmachen.
Solche Leidenschaftlichkeit bei der Annäherung an Gott mag heute erstaunen. Doch müsste sie angesichts des biblischen Hauptgebotes nicht auch irritieren und ergreifen? Der Allmächtige will ja nicht nur Wahrnehmung, Respekt und Gehorsam vom Menschen. Er möchte in seinem Sohn von uns wirklich geliebt werden „mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit allen Gedanken und mit ganzer Kraft“ (Dtn 6,4f; Mk 12,20) - alldieweil wir doch schon menschliche „Liebe“ als das Beglückendste und Erschütterndste überhaupt erleben. Demnach können die Kirchenväter sogar allen Helfer werden, die großen Ruhmesgebete der Kirche - wie das „Ehre sei dem Vater“, das „Gloria“ der Hl. Messe, das „Te Deum laudamus“ - nicht nur mit den Lippen, sondern mit wachem Gemüt zu sprechen.
Dreifaltigkeit: Quelle und Ziel von Gemeinschaft
Die Suche nach der Einheit mit anderen Menschen hat Glaubende die Trinität entdecken lassen. Der dreifaltige Gott bestimmt die Richtung, die für den einzelnen und für die Gemeinschaft gültig ist. In den geoffenbarten Aussagen des göttlichen Erlösungswerkes ist er ablesbar: das Neue Testament und die Kirchenväter der ersten Jahrhunderte künden die durch Christus im Heiligen Geist geschenkte Gemeinschaft mit unserm väterlichen Ursprung. Und wer über das Staunen vor Allmacht und Größe hinaus sich dem Du des Heilbringers Christus zuwendet, den vereinnahmt die theologische Logik: Gott selbst muss es sein, der die Aufhebung von Zwietracht und Trennung unter den Menschen wirkt; denn was die Theologen in mühevollem Suchen von seinem Geheimnis entschlüsselt haben, beweist ihn ja als „Prototyp" von geeinter Vielheit und von mehrfältiger Einheit. „Trina unitas et unita Trinitas - dreifache Einheit und geeinte Dreiheit" nennt ihn der Bischof Quodvultdeus (+ 453). Und über den Besuch der drei Engel bei Abraham (Gen 18) sagt er: „Er sah die drei (Personen) und verehrte Einen Einzigen“.
Die Kirchenväter Quodvultdeus und Ambrosius sind westliche Theologen. Sie geben der älteren Trinitätslehre der Griechen einen neuen Akzent. Die Lehrer des Ostens stellten die Gemeinschaftlichkeit der göttlichen Hypostasen heraus. Sie betonten dadurch, dass Gottes Gemeinschaft nicht bloß in der Einheit der göttlichen Natur liegt. Er ist nämlich keine kalte unpersönliche Gottheit, sondern bewegt von Liebe und Leben. Die Lateiner stellen andererseits heraus, dass diese Terna die Einheit und Untrennbarkeit Gottes nicht mindert. Sie heben den Monotheismus stärker hervor, das Prinzip, das verwirrende Vielheit sammeln kann. Beide Perspektiven ergänzen sich. Sie zeigen die Dreifaltigkeit als Archetyp der KOINONIA/Communio: ln ihrer Dreiheit wird sie zur Quelle, aus der Gemeinschaft entspringt; sie ist ferner das Ziel, in dem sich Gemeinschaft für Kirche und Menschheit endgültig verwirklicht. Ihre Darlegungen geben demnach nicht nur theologische Eckdaten. Sie bewegen auch dazu, bei der kirchlichen Gemeinschaftssuche Gott nicht aus dem Blick zu verlieren, sondern sie gerade von ihm zu erhoffen.
Hilarius von Poitiers (+ 367) liest aus dem Wort des johanneischen Christus von dessen Verbundenheit mit dem Vater - „Wie du Vater in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns eins sein…“ (Joh 17,21): Der Herr habe „durch den Aufweis des Urbildes der Einheit“ hinweisen wollen „auf die Herkunft der Einheit“. Anschließend nennt dieser Kirchenvater die Gemeinschaft zwischen Vater und Sohn dann die „Grundform der Einheit“ für alle Menschen. An anderer Stelle bringt er Einzigkeit und Liebesgemeinschaft unseres Gottes auf den tiefen Satz: „Gott ist einer, aber nicht allein.“
Auch wenn zunächst bei der Betrachtung des trinitarischen Mysteriums die dritte Person in der Gottheit nur am Rande benannt wurde, so wird der Heilige Geist auch von den lateinischen Kirchenvätern keineswegs übersehen. Eine besonders lichtvolle Erkenntnis gelingt Augustinus (+ 430) über die Sendung des göttlichen Beistands, die von unbestreitbar hoher Aktualität für heutiges Einheitsverlangen ist.
Der Theologe befragt die Namen, die die dritte Person in der Gottheit für die Glaubenden trägt. Seine Bezeichnung „Heiliger Geist“ scheint diese Person zunächst nicht eindeutig bestimmen zu können, da von der Schrift selbst auch Vater und Sohn als „heilig" und als „Geist" bezeichnet werden. Dennoch wird dem Bischof aus Hippo dann die Tatsache, dass „Heiliger Geist" das den beiden anderen göttlichen Personen Gemeinsame benennt, zum Schlüssel für das Verständnis gerade dieser Person: Wenn er das Göttliche Gottes, das dem Vater und dem Sohn Gemeinsame, sei, dann liege sein Wesen eben darin, Communio von Vater und Sohn zu sein.
Das Besondere des Heiligen Geistes ist offensichtlich, dass er das Gemeinsame von Vater und Sohn ist. Seine Besonderheit ist es, Einheit zu sein.
So bindet auch Augustinus die Antwort auf die Einheitssehnsucht an die Trinität selbst: Christ zu werden heißt, durch den Heiligen Geist in Communio zu treten, und zwar in die Communio, die Gott selber ist. Oder heilsgeschichtlich zutreffender: Gottes Geist ist die Communio, die die Einigung der Menschheit wirkt. Joseph Ratzinger kommentiert:
Geist ist Einheit, die Gott selber schenkt, in die er sich selber schenkt, in der Vater und Sohn sich einander zurückschenken. Sein paradoxes Proprium ist es, Communio zu sein, höchste Selbstheit gerade darin zu haben, ganz die Bewegung der Einheit zu sein.
Und nach den Lateinern nochmals der Grieche Gregor von Nyssa. Er verheißt der Seele für ihre Erfahrung des innertrinitarischen Leben Gottes: Die Fülle des Lebens erwartet sie, so dass Ruhe und Bewegung für sie zusammenfallen.
Wisse, sagt Gott zur Seele, dass es bei mir eine solche Fülle an Raum gibt, dass der ihn Durcheilende in seinem Flug nie innehalten wird. Aber dieser Flug ist aus einer anderen Sicht die Ruhe: „Ich werde dich auf den Felsen stellen.“ Hier liegt der Gipfel des Paradoxen: Ruhe und Bewegung sind identisch… Und je mehr einer sich im Guten festigt und unbeweglich wird, desto rascher wird sein Flug; die Ruhe selbst dient ihm als Schwinge.
Pastoraler Dreh- und Angelpunkt: „Gott nicht voraussetzen, sondern vorsetzen“ (H. U. von Balthasar)
Theozentrische Faszination kann sich in Gott vertiefen - den Menschen vergessen. Sie kann dann Anteil geben am trinitarischen Leben selbst, wenn nur Gottes Nähe aufrichtig gesucht wird. Und zu unserm Trost ist festzuhalten: Begeisterung für Gottes wunderbare Dreiheit ist keineswegs ein mit den frühchristlichen Jahrhunderten definitiv verschütteter Brunnen. Sie ergießt sich immer wieder neu. Etwa in dem Werk der Mystikerin Mechtild von Magdeburg (+ 1282) „Das fließende Licht der Gottheit“ (Anm. Vgl hierzu H. U. von Balthasar, Theodramatik IV, Einsiedeln 1983, 357f.). In diesen Visionen legt die Ordensfrau ihre Erfahrung mit Gottes trinitarischem Leben nieder. Gott ist ihr ein ewig fließender Brunnen. Er berührt sie mit seiner ewig quellenden Flut. Die Seele hinwieder strömt dann zu Gott zurück; sie ertrinkt wie der Fisch im Meer, und je geringer sie selbst, Mechtild, wird, um so mehr fließt ihr zu. Das Ergebnis ist ein gegenseitiges Sich-Anstrahlen und die Begegnung mit der ganzen trinitarischen Liebe:
Woraus bist du erschaffen, o Seele, dass du so hoch steigst über alle Kreaturen und dich mengest in die heilige Dreifaltigkeit. Und doch ganz in dir selber bleibst?
So beschreibt die Mystikerin das Einbezogenwerden des Menschen in den überschäumenden Strom des trinitarischen Lebens. Und sie begnügt sich nicht damit, ihre eigene selbstvergessene Entrückung und trunkene Gottes-Verehrung aufzuzeichnen. Was ihr geschenkt wurde, steht auch andern Glaubenden und Liebenden offen. Darum will sie ihre Erfahrung möglichst vielen Zeitgenossen mitteilen. Zur Einleitung versichert sie:
Dieses Buch sende ich nun als Boten allen geistlichen Leuten, beiden: bösen und guten. Es ist nur ein Bild meiner selber und sagt hold mein Heimlichstes aus. Man soll es freundlich annehmen: Gott selber spricht die Worte.
Nach einem der bedeutendsten Experten der „Mystik des Abendlandes“ – Bernhard McGinn (* 1937) - blieb die Resonanz von Mechtilds trinitarischer Liebesdynamik keineswegs auf einen kleinen Kreis von Christen beschränkt. Die von ihr beschriebene Fülle war Antrieb auch für die mittelalterliche Reformbewegung der „Gottesfreunde“, die unter Laien, Priestern wie Ordensleuten beachtliche Glaubensfrüchte zeigte.
Nota bene:
Der dreifaltige Gott sollte unter Glaubenden nie als ohnehin bekannt vorausgesetzt werden. Sein Angesicht ist in jeder Phase der Geschichte anziehend. Wenn er bedacht und verkündigt wird, beglückt er die mit seiner Liebe, die sich ihm aussetzen. Ob der großen Weltsynode wohl ein Wechsel der Perspektive gelingt und sie anfängt, neben dem Menschen von heute dem ewigen Gott mehr Raum zu geben?